| Diese Ausgabe downloaden
(zip ca. 94 kb) |
Diese Ausgabe ausdrucken
|
 |
das virtuelle Kybernetik-Magazin
the virtual cybernetic magazine
ausgabe 5 - august 2001 - issn 1439 - 8850
| Diese Ausgabe downloaden
(zip ca. 94 kb) |
Diese Ausgabe ausdrucken
|
 |
ausgabe 5 - august 2001 - issn 1439 - 8850
(Deutsche) Gesellschaft für Kybernetik Bericht von Siegfried Piotrowski Nachruf auf Francisco J. Varela von Alfred Locker, Wien Der PC feiert seinen 20. Geburtstag aus c't 16/2001 Tertium Datur. Gotthard Günthers Entwurf einer genetisch-topologischen Logik Auszug aus einer Arbeit von Kai Lorenz Bemerkungen zum Begriff Kommunikation von Gerd Hartmann Kybernetik - Philosophie - Gesellschaft Anmerkungen zur Tagung am 14. April 1961 von Rainer Thiel Impressum
(Deutsche) Gesellschaft für Kybernetik e. V.
Siegfried Piotrowski

Anläßlich der Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Pädagogik und Information (GPI) e. V., die am 15. Juni 2001 in Verbindung mit der Vergabe der Comenius - Auszeichnungen im Europäischen Haus in Berlin stattfand, gab der stv. Direktor folgenden kurzen Zwischenbericht ab:
"1. Zusammen mit Europa Klub und Stiftung Europaverständigung wird wieder ein "Berliner November- " durchgeführt. Es wird am Freitag, 9. November in zwei Sektionen (I: Linguistik, II: Kybernetik) gearbeitet, am Samstag wird der Preis für Gesellschafts- und Organisations- kybernetik verliehen.
2. Der Vorstand der GfK wird bei der Mitgliederversammlung am 10. November neu gewählt und (möglichst) verjüngt. Die Arbeit des Vorstands wird intensiviert.
3. Die Satzung des Vereins wird überarbeitet und von "Ballast" befreit.
4. Das Statut des Wiener-Schmidt-Preises wird auf der von Herrn Professor Dr. Lehnert erar- beiteten Basis neu beschlossen, muß aber für mögliche Preisträger noch weiter geöffnet werden.
5. Sollte die GPI im Jahre 2002 eine Veranstaltung in Wien durchführen, wird dann dort auch der Wiener-Schmidt-Preis vergeben."Leider war es nicht möglich, die für die GPI-Veranstaltung genutzten Räume im Europäischen Haus in Berlin kostenlos für den Berliner November zur Verfügung gestellt zu bekommen. Mit Hilfe von Herrn Kollegen Professor em. Dr. phil. Herbert Stachowiak konnten inzwischen er- freulicherweise für den 9. und 10. November 2001 Räume im Clubhaus der Freien Universität Berlin, Goethestr. 49, 14163 Berlin reserviert werden.
Das vorläufige Programm für die Konferenz "Bildung und Kommunikation in und für Europa" finden Sie in der 18. Ausgabe (Juli 2001) von europa dokumentaro unter
http://www.europa-dokumentaro.de
Die in Aussicht gestellten Referate lassen eine interessante Veranstaltung erwarten. Zur aktiven oder auch passiven Teilnahme an der Konferenz können Sie sich ab sofort unter der eMail- Adresse gfk@piotrowski.de anmelden.
Leider kann aus der hervorragenden Arbeit von Kai Lorenz zu Gotthard Günther nur ein (ver- hältnismäßig kleiner) Auszug veröffentlicht werden. Die komplette Fassung können Sie als Printversion anfordern (bitte DM 5,-- Postwertzeichen beifügen) bei Siegfried Piotrowski, Post-
fach 27 42, D- 58027 Hagen.Gerd Hartmann stellt "Bemerkungen zum Begriff Kommunikation" zur Diskussion. Ob eine lebhafte Diskussion dadurch angestossen werden kann ?
DER SPIEGEL widmet in seiner Ausgabe 30 vom 23. Juli Professor Dr. Dr. h. c. Günter Tembrock einen Beitrag. Falls Sie diese Ausgabe nicht mehr bekommen, können Sie eine Kopie anfordern. Günter Tembrock hat anläßlich des Berliner November 2000 das Referat "Die Biokybernetik in der DDR" gehalten.
Die Referate sowohl zum Berliner November 1999 als auch 2000 sollen in diesem November zunächst als Manuskriptbände vorgelegt werden.
Waren Sie schon auf den Internetseiten
http://www.pomoerium.com
des neuen GfK-Mitglieds Dr. Ryszard Pankiewicz ?
Die am 31. August 2000 von der Mitgliederversammlung beschlossene Satzungs-/Namens- änderung des früheren Institut für Kybernetik Berlin e. V. / Gesellschaft für Kommunikations- kybernetik in
Gesellschaft für Kybernetik e. V. ist am 30. Juli 2001 in das Vereinregister bei dem Amtsgericht Charlottenburg eingetragen worden.
Die Kybernetik und System-Theorie hat durch den Tod des Francisco J. Varela (+ 28. Mai 2001) einen schweren Verlust erlitten. Ursprünglich als Mediziner und Biologe (geb. 1946) (graduiert in Harvard) Schüler und Mitarbeiter H. Maturanas in Chile, machte er sich durch die gemein- same Publikation des Werkes "Autopoiesis and Cognition" (1980) einen Namen, wobei (a) Leben als Kognition definiert wurde und (b) der Selbstreferenz des Organismus durch den Begriff "Autopoiesis" terminologische Prägnanz verliehen wurde. Varelas Hauptwerk war kurz vorher erschienen: "Principles of Biological Autonomy" (1979), in dem er durch einen von ihm konzi- pierten "Calculus of self-reference" (Int.J,Gen.Syst. 2, 5-24 (1975)) diesem Problem formalzuleibe zu rücken versuchte. Im deutschen Sprachraum ist sein (mit Maturana) veröf- fentlichtes Buch: "Der Baum der Erkenntnis" bekannt geworden. Zuletzt war V. am CREA (Ecole Polytechniques) in Paris als Forschungs- direktor tätig, wo er sich dem Ursprungsproblem ebenso zuwandte wie dem Thema des Artificial Life".
Der PC feiert seinen 20. Geburtstag
Die Erfolgsgeschichte des Personal Computers
aus c't Ausgabe 16/2001

Mittwoch, der 12. August 1981 in New York: IBM präsentiert den PersonalComputer (PC), der zusammen mit seinen unzähligen Nachfolgern in den folgenden zwei Jahrzehnten weltweit auf 97 Prozent aller Schreibtische stehen wird. Das Computermagazin c't beleuchtete diese einmalige Erfolgsgeschichte in der Ausgabe 16/01.
Unter größter Geheimhaltung hatte ein Team von zwölf Ingenieuren innerhalb von 18 Monaten den IBM PC 5150 entwickelt und auf den Markt gebracht. Er war die Antwort der bis dato un- bestrittenen Computergroßmacht IBM auf einen neuen Markt preisgünstiger Spiel- und Schreib- tischrechner von Apple, Commodore oder Tandy. Dessen Bedeutung hatte IBM lange unter- schätzt. Deshalb gab es von IBM vor allem eine Devise für die Entwickler: Hauptsache günstig. Die billigste Ausführung des ersten IBM-PC ohne Diskettenlaufwerk und Festplatte kostete mit 1560 US-Dollar weniger als ein Zehntel des sonst üblichen Computerpreises.
Der PC wa sowohl für Telespiele, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation als auch für Präsenta- tionsgrafiken geeignet. In fünf Jahren wollte IBM 250.000 Rechner verkauft haben. Stattdessen ging der einmillionste PC bereits 1984 über den Ladentisch. Recht schnell hat IBM seine Markt- macht alerdings an andere PC-Hersteller verloren. Die einfache Bauart und die perfekte techni- sche Dokumntation machte es der Konkurrenz sehr leicht, Kopien dieser günstigen Schreibtisch- Rechner anzubieten.
Heute werden die Leistungsdaten der Oldie-PCs um den Faktor 1000 und mehr übertroffen. Und doch hat der Ur-PC noch immer seine Finger mit im Spiel: "Selbst jetzt findet man in moderns- ten Pentium-4-Maschinen zuhauf Restbestände einer übrigens schon damals teilweise veralteten Hardware," erklärt c't-Redakteur Andreas Stiller. "Dasselbe gilt für die Software." Microsoft- Gründer Bill Gates konnte bei IBM den Windows-Vorläufer DOS unterbringen, das der heutige Milliardär für wenig Geld einem Software-Entwickler abgekauft hatte.
TERTIUM DATUR.
GOTTHARD GÜNTHERS ENTWURF EINER GENETISCH-TOPOLOGISCHEN LOGIK
von Kai Lorenz [kai.lorenz@berlin.de]

Einführung
Die hier in Auszügen dokumentierte Arbeit versucht am Material der veröffentlichten Güntherschen Schriften die Vermutung zu explizieren, daß Günthers Problemsensibilität an der Eigentümlichkeit sozial- und geisteswissenschaftlicher Gegenstände erregt wurde, nicht durch unmittelbare Evidenz beglaubigte Ursachen für erfahrbare Wirkungen zu enthalten.
Naturwissenschaftliche Gegenstände bestehen, vereinfacht, immer aus der Rekonstruktion von Kausalbeziehungen, in denen auch die Ursachen Phänomene sind, also mindestens indirekt beobachtbar. Bei Gegenständen sozial- und geisteswissenschaftlicher Analyse hingegen hat man keine beobachtbaren Ursachen zur Verfügung, sondern muß zur Erklärung (die hier üblicherweise Deutung genannt ist) Hypothesen über Triebe, Strebungen, Interessen, Motive unterstellen, die nie sichtbar werden können. Es ließe sich vermuten, daß die Hypothesen dann doch dadurch zu begründeten Annahmen werden könnten, daß eine überzeugende Rekonstruktion beobachteten Handelns und Verhaltens geleistet würde. Dem steht die Erfahrung entgegen, daß die Wahl der Hypothesen die spezifische Beleuchtung und Auswahl der zu deutenden Phänomene bereits bestimmt, daß also der Entschluß zur theoretischen Aufklärung über Gründe und Bedingungen ‘beobachteten Verhaltens’ - wozu eben nicht nur im strengen Sinne Beobachtetes zählt, sondern auch Sprechakte - bereits von stillen Vorentscheidungen über die theoriewürdigen Aspekte der thematisierten Wirklichkeit gezeichnet ist.
Das Problem besteht bereits außerhalb theoretischer Bezugnahme auf Gegenstände, im alltäglichen Verstehen. Hier wird selbstverständlich angenommen, daß ‘verständliches’ Verhalten durch Gründe erklärbar ist, die innerhalb eines eingelebten Erwartungshorizonts liegen. Was außerhalb dessen anzunehmen wäre, verfällt leicht Verdikten, seien es ästhetisch-geschmackliche, moralisierend abwertende oder gar pathologisierende Beurteilungen des Verhaltens Anderer. Solche Abwehrhaltungen lassen sich damit erklären, daß die Unterstellung von bis dahin noch nie zugelassenen Gründen für bestimmtes Verhalten den Beobachter zu einer umstürzenden Veränderung seines eigenen ‘symbolischen Haushalts’ nötigt: er verwandelt sich im Versuch, etwas zu verstehen und begründet zu beurteilen, wenn er dafür Möglichkeiten menschlichen Daseins für zulässig erachten muß, die ihm bisher im Bereich des Undenkbaren oder doch wenigstens des Unerlaubten lagen.
Ob sich der Beobachter zu solcher Selbstverwandlung nötigen läßt oder nicht - in jedem Falle wird von ihm auch der Beobachtete beeinflußt werden, wenn zwischen ihnen mehr als das nur dem Wortsinn von Beobachtung Entsprechende geschieht, wenn sie also wahrhaft miteinander agieren. Im alltäglichen Verkehr zwischen Menschen verschiedener sozialer Schichten, verschiedener Berufskulturen, verschiedener geographischer Regionen wird unentwegt, wenn auch unausdrücklich, die Erfahrung gemacht, daß die Art und Weise, wie A B versteht, B in verschiedenem Maße fordert, nötigt oder bereichert. Es ist naheliegend, sich daran zu erinnern, daß A nicht beim kontemplativen Deuten bleibt, sondern danach handelt - und B behandelt. Dessen Reaktionen sind dann wiederum so beschaffen, daß sie A zu einer fortschreitenden Revision seiner Deutung von B auffordern.
Gotthard Günther untersuchte Konstellationen dieses Typs ebenso wie all jene Forscher im 20. Jahrhundert, die für ihre Gegenstandsbereiche ‘Wirkungskreise’ als Mittel der Rekonstruktion entdeckten; Synergetik, Selbstorganisation und Autopoiesis sind Stichworte für Theorietendenzen, in denen solche Aufmerksamkeiten ausgebildet wurden. Günther selbst hatte den Anspruch, so die grundlegende Intuition, der unsere Arbeit folgt, ein dem geschilderten Typus von Erfahrungen angemessenes Wirklichkeitsbewußtsein zu befördern. Im Kern wäre dies eines, das nicht mehr von einem der Bezugnahme gegenüberstehenden substantialen Sein ausgeht, sondern das Sein des Gegenstandes von der Bezugnahme auf ihn konstituiert zu denken versuchte - das also die naive Unmittelbarkeit der alltäglichen Normalwahrnehmung für einen Sonderfall hält, dessen Verallgemeinerung heute nur noch Täuschung erzeugen könnte. Daß dabei kein beliebig-radikaler Konstruktivismus als theoretische Lösung befriedigen kann, ist Günthers prinzipieller Ausgangspunkt; er hat eine solche Haltung als einen ‘Nihilismus’ immer abgewehrt.
Seine Aufmerksamkeit richtet sich vordringlich auf das Gefüge der Wechselbeziehungen, in denen Bezugnahme Gegenstände konstituiert und zugleich Gegenstände Weisen des Umgangs mit ihnen präformieren. Er gelangt dabei zu der Einsicht, daß die konstituierende Bezugnahme auf Sachen immer in die Bezugnahme auf Andere verwoben ist und hofft, durch die Rekonstruktion der Wechselbeziehungen als Folgen transformierender Akte ein universelles Beschreibungsmittel schaffen zu können, mit dem die wechselseitige Beeinflussung und die von ausgelösten Wirkungen ausgelösten Umwandlungen systematisch konstruiert werden sollen. Das ideale Ergebnis dieser Bemühungen wären ein Alphabet und Operatoren für die quasi-mathematische Konstruktion aller je möglichen Konstellationen kultureller Bedeutungen, gewissermaßen aller je möglichen ‘Figurationen von Fakten’. Dieses Beschreibungsmittel hat Günther „transklassische“ oder „nicht-Aristotelische“ Logik genannt, auch „operationale Dialektik“ oder auch „meontische“ Logik (nach dem griechischen to mé on, das Nicht-sein).
Die hier dokumentierte Arbeit war im Ganzen dem Versuch gewidmet, die Genese des Theorieprogramms, die einbezogenen Theorietraditionen und die Lösungsversuche zu rekonstruieren. Was sie zu zeigen vermag und welche Einsichten sie eröffnen kann, wird sich erweisen. Uns scheint eine der dringlichsten Aufgaben darin zu bestehen, von Günthers Arbeit genährte Hoffnungen auf die mathematische, gar steuerungstheoretische Modellierung der oben skizzierten zirkulären Prozeßdetermination in kommunikativen Beziehungen zu ernüchtern und der Frage nachzugehen, ob eine solche nicht eine falsifizierende Unterstellung physikalischer Kausalität zur Voraussetzung hätte. Ihre theoretische Hypothek wäre dann nämlich, eine strikte Reiz-Reaktions-Kopplung im menschlichen Verhalten zu unterstellen, die von der Anthropologie in wünschenswerter Weise und mit guten Gründen bestritten wird.Der folgende Auszug entstammt dem vierten Kapitel, in dem „Programm und Theoriekern“ der Güntherschen Philosophie rekonstruiert werden. Der Akzent liegt hier darauf, seine Bemühung um Operatoren der ‚Bewußtseinserweiterung‘ verständlich zu machen und daraus eine Interpretation seiner Kritik der zweiwertigen Formalen Logik zu entwickeln.
...
Grenzüberschreitungen
‘The Frontier’
Im Lebensgang Günthers zeigte sich, wie die einmal aufgeschlossene Problemsicht in Kulturräume leiten konnte, die praktische Kommunikationserfahrungen versprachen, an denen das Erahnte präziser zu bestimmen möglich erschien. Wie mancher andere Immigrant aus Europa konnte Günther in den USA eine innovative, experimentierfreudige Lebensform als vorherrschende erkennen, aber seiner diagnostischen Aufmerksamkeit und seiner konstruktiven Vorhaben wegen hatte er dabei weniger intellektuelle Revisionen vorzunehmen als es mancher allein vom Reichtum der europäischen Kulturgeschichte zehrende Kopf hatte tun müssen. An der Mentalität der Bevölkerung fasziniert ihn der konsensorientierte Zug, der über allem die prinzipielle Gleichheit, Gutwilligkeit, Verstehbarkeit und Verständnisfähigkeit aller Personen unterstellt. Geprägt von der Erfahrung der immer weiter vorrückenden Grenze, die mit der Eroberung des Westteils des Kontinents im 19. Jh. einherging, habe sich eine, noch die verschiedensten lokalen Differenzen integrierende, gemeinsame Idee im topos der ‘frontier’ ausgebildet [1], der ein auf situative Abstimmung und die Bereitschaft zum Experimentieren und Erproben gerichteter Zug im alltäglichen kommunikativen Handeln zu verdanken sei. Er übersetzt sich den Terminus Pragmatismus in diesem Sinne und erkennt in ihm die Grundlage eines neuen Weltverständnisses jenseits rückwärtsgewandter mystischer Esoterik, wie er sie etwa bei Heidegger kulminieren sieht. Er nennt es noch dazu einen ungoetheschen Pragmatismus, da auch Goethe, trotz des Wortes Was fruchtbar ist, allein ist wahr, doch nie Zweifel am Evidenzcharakter des Wahren gehegt habe [2].
Der unentwegte ‘Blick nach vorn’ aber, den er den US-Amerikanern abliest, die Orientierung auf den Möglichkeitsraum, in dem gehandelt wird, entstamme einem abgrundtiefen Mißtrauen gegen jene innere Evidenz, die in Menschen entsteht, die durch ein gemeinsames historisches Schicksal geformt worden sind[3]. Es gebe so keinen ‘spirituellen Konsens’, der die Beglaubigung von Urteilen durch Rückgriffe auf ein Sediment von aus Erfahrungen gebildeten Überzeugungen und Wertvorstellungen sichere. Daß er tatsächlich einen zum Schlagwort verdichteten kollektiven Erfahrungsschatz dieser Kultur anruft, wenn er den Kern der US-amerikanischen Mentalität im Geist der Frontier-Erfahrung sieht, also in der stilisierenden Interpretation einer Situation des seiner Voraussetzungen nicht bewußten und immer perpetuierten Anfangens in einen kulturell vermeintlich leeren Raum hinein, ist ihm nicht bewußt. Denn was ihn dabei tatsächlich interessiert, ist der Unterschied des Vorrangs von Horizonten der Erinnerung und Tradierung in Europa gegenüber denen des zukünftig Möglichen in den USA, also ist ihm nicht kein spiritueller Konsens die wesentliche Differenz, sondern die Orientierung auf das Realisierbare statt auf die Erfahrung des Geschehenen. Daß hier mehr als der Anschluß an die Weltanschauung nordamerikanischen Wehrbauerntums gesucht ist [4], formuliert er als eine Diagnose, die von einer Aufgabenformel nicht zu unterscheiden ist: Nach der Erschöpfung des physischen Raumes erfolge nun eine Sublimierung ins Reich des Intellekts. Die Schlußfolgerung gewinnt an Gewicht, erkennt man in ihrem Anlaß die besondere Gestalt einer allgemeinen Erfahrung des 20. Jahrhunderts, die Alfred Weber in dem Urteil aussprach, es gebe nun auf dem Globus keinen Ort mehr, an dem der Mensch nicht mit Resultaten seiner Tätigkeit konfrontiert sei [5]. Obschon diese Erfahrung heute ubiquitär erscheint, ist sie noch kaum systematisch bewußt gemacht worden, so daß, ihre Bedeutung für die Prämissen einer philosophischen Theorie auszumessen, keine erledigte Aufgabe sein dürfte.Science fiction
Daß Günther durch seine programmatische Orientierung auf die intellektuelle Verarbeitung der neuen Erfahrungen vorbereitet ist, beweist sich in deren Integration in das Bündel intendierter Anwendungen des gesuchten Kerns begrifflicher und systematischer Mittel, die aus der thematischen Verwandtschaft einen Fortschritt der Konkretisierung zu gewinnen erlaubt. Das in den Umrissen einer Vermittlung des ‘Wissensraums’ Vergangenheit mit dem zu diesem disparat gewordenen ‘Entscheidungsraum’ Zukunft erahnte Thema öffnet sich hier Phänomenen, die nicht erst mit dem Ende des Krieges auffällige geworden waren. Dieser war nur eine enorme Beschleunigung von Entwicklungen gewesen, deren erste Züge sich bereits angekündigt hatten. Die Atombombe [6] demonstrierte auf eklatante Weise, was auch auf anderen Entwicklungsfeldern der Technologie geschehen war, die Raketentechnik ermöglichte die Raumfahrt und die Nachrichtentechnik wurde zur Quelle allgegenwärtiger technischer Datenbearbeitung. Mit moderner Technologie wurden offenbar Optionen geschaffen, für die es in der bisherigen Menschheitsgeschichte kein analogon gab und die Geschwindigkeit des Wandels traf zudem auf ein Vorstellungs- und Begriffsvermögen, das ihm kaum gewachsen war [7]. Die Vermutung, daß Günther in der science fiction-Literatur ein Medium entdeckt, das hier Dienstfunktion übernimmt, schlösse eine interpretatorische Lücke, in der sonst die Aufmerksamkeit dieses deutschen Philosophen für Weltraumgeschichten als bloßer spleen anzusiedeln wäre. Mehr noch: hier wird die These vertreten, daß in dieser Neugier ein Schlüssel zum Kern der Güntherschen Philosophie vorliegt. Die phantastischen Erzählungen über Planetenreisen, intelligente Roboter und die Verwandlung der Lebensformen in einer restlos technologisch organisierten Lebenswirklichkeit verhandelten Themen, die keimhaft in realisierten Innovationen angelegt und in Tendenzen vorgezeichnet schienen, so daß ein Theoretiker, der als Zentrum seiner intellektuellen Anstrengungen nun die futurische Dimension der zeitlichen Existenz des Menschen bestimmt hatte, hier Neugier entfalten konnte, wie obskur die neue Literaturgattung nach Maßstäben der etablierten Bildungskultur auch erscheinen mochte [8]. Zwar nahm Günther die Erzählungen dieser Gattung ‘realistisch’ [9], doch teilt er das nicht nur mit der Mehrheit seiner Zeitgenossen, die mit den Möglichkeiten neuer Technologien die Erwartung verbanden, sie könnten zu Begegnungen mit unbekannten unirdischen Zivilisationen führen, die dem Menschen neue Facetten seiner Daseinsmöglichkeiten aufschlössen, so fremd und jenseits alles Erwartbaren, daß nur der Gestus des Rätselhaften und der Andeutung ihrer Erörterung angemessen wäre, sondern er findet hier auch Spuren, die seiner Grundintuition korrespondieren, durch moderne soziale Verhältnisse geschaffene Konflikte und ihre Sackgassen müßten durch nicht mehr in herkömmlicher Weise planbare Ausgriffe in Neuland überschritten werden. Im Nachwort zu einem der von ihm herausgegebenen „Weltraum-Bücher“ [10] schreibt Günther, daß die Autoren der science fiction-Literatur durch einen gemeinsamen spirituellen Habitus charakterisiert seien und die gleiche Methode der Extrapolation [11] verwendeten. Die zuerst als Verlängerung gegenwärtiger Entwicklungstendenzen in die Zukunft erläuterte Methode wird in einer präziseren Bestimmung dann doch auch anders, als Explikation von Sachverhalten und sozialen Konstellationen aus einer freien, wunschbestimmten Setzung primärer Annahmen gefaßt. Hier besteht noch Unbestimmtheit hinsichtlich des Verfahrens, mit dem über die Bruchlinie zwischen eingelebten Prägungen und Traditionen und den von ihnen determinierten Erwartungen einerseits und dem explosiv geöffneten Möglichkeitshorizont der nächsten Zukunft andererseits erkundende intellektuelle Entwürfe methodisch bewußt operieren könnten.
Eine schwerlich überzeugende Argumentation entwickelt Günther mit der These, der ‘quantitative Umfang’ des Bewußtseins sei direkt proportional dem quantitiven Umfang der Umgebung, in der es existiere [12]. Daß mit letzterem der Wirk- und Bewegungsraum eines irritablen Organismus gemeint ist, wird in der gefundenen Formulierung zwar nicht mehr deutlich, ist jedoch dem Kontext der Stelle zu entnehmen. Daß die nicht mehr terrestrische, sondern galaktische, sogar transgalaktische Lebensform des Menschen der Zukunft [13] einen adäquat erweiterten Bewußtseinsumfang erfordere, ist eine Behauptung, die im Gang des Güntherschen Denkens dann merkwürdig verquer steht. Die bloße Tatsache eines räumlich erweiterten Wirkungskreises allein könnte solch eine Erweiterung des Bewußtseins nicht erzwingen, wie an Zeitgenossen zu beobachten ist, die, mit allen Bequemlichkeit gewährenden technischen Hilfsmitteln unterstützt, weite Reisen zu fremden Kulturen unternehmen, ohne ihre Heimat, Lebensgewohnheiten und Wertvorstellungen, geistig jemals zu verlassen. Umgekehrt ist es möglich, ohne weite Reisen zu unternehmen, bei hinreichender innerer Freiheit und Sensibilität im nächsten alltäglichen Umkreis tiefgreifende Einsichten und Erfahrungen zu gewinnen [14]. Was also zu vermuten wäre, ist eine Abhängigkeit des ‘Bewußtseinsumfangs’ von einem gewissermaßen qualitativen ‘Umfang’ der Umwelt, in der Orientierungs- und Kommunikationsleistungen zu erbringen sind [15]. Der Grad an Erwartungen brechenden Differenzen und Inkongruenzen, die analogisierende Verallgemeinerungen erschwerten oder gar verunmög- lichten, bestimmte demzufolge den ‘Umfang’ von Bewußtsein. Da dies nicht nur die naheliegende, sondern sogar die in anderen Texten Günthers explizit vertretene These ist [16], zudem diejenige, die den nervus rerum seiner Hegelinterpretation ausmacht [17], erscheinen die im hier diskutierten Text gefundene Formel und die ihr zugehörigen Argumente doppelt irreführend. Die verschwiegene, weil nicht durchschaute Unterstellung, es handele sich bei der ‘Umgebung’ des Bewußtseins um die empirisch-räumliche, d. h. durch physische Kausalbeziehungen konstituierte Welt, in der ein Organismus lebt, zudem ihre Vorstellung nach Maß der anschaulichen Alltagsumwelt des empirischen Horizonts, führt die eigentliche These im gegebenen Text nur verborgen mit: unsere empirisch anschauliche Umwelt kann für uns so beschaffen sein, daß die Erweiterung des Aktionskreises bereits zu einem Zuwachs an bloßem Faktenwissen führt. Die jenseits bloßer Datenmassen zu postulierende qualitative Erweiterung des Bewußtseins, die einem Wechsel von terrestrischer zu ‘stellarer’ Lebensweise zugehöre, vermag Günther zwar terminologisch abzuheben, suspendiert sie aber als Thema vorläufig [18], um sie im Ganzen des Texts schließlich unerörtert zu belassen.
Die Vorstellung der frontier im Raum wird darum auch nicht klar von der Metapher der ‘Front’ im Reich des Intellekts geschieden [19], was dann einer eigentümlichen und fruchtbare Ausblicke versprechenden, gleichwohl unbewußten Verschiebung klassischer Metaphorik zu dienen hat. Die Ausweitung des Aktionsraumes des Menschen in den Kosmos, die als Übertragung des spirituellen Habitus der frontier- Mentalität vom geographischen auf den Weltraum erscheint, soll zugleich allegorisch gelesen werden, denn mit überraschender Plötzlichkeit wird aufgedeckt, daß der astronomische und der religiöse ‘Himmel’ nicht unbezüglich nebeneinanderstehen. Diese Identifikation des kosmischen Raumes mit einer geistigen Dimension, die der Mensch, so wie er auf der Erde lebt, nie erreichen kann, ist keineswegs ein bloßer Zufall .. Das eigentliche Wesen beider ist gänzlich jenseits der Bewußtseinskapazität des irdischen Menschen. Mit einem sich als durchgehend erweisenden Bezug wird erklärt: Deshalb kann man erst nach dem Tode in den Himmel kommen. Der Tod ist hier diejenige Instanz, die das an diese Erde gebunden Bewußtsein von seinen Fesseln befreit und es für die im Diesseits unbegreiflichen Erlebnismöglichkeiten des Jenseits ‘verklärt’[20]. Welchen präzisen Sinn der Terminus ‘Tod’ haben sollte, wenn er in Parallele den Seelenaufstieg ins Jenseits ebenso zu bezeichnen hätte wie den physischen Ausgriff in unbekannte kosmische Regionen, bleibt unausgemacht [21]. In nicht immer klar verlaufenden Linien sind aber darin die Spuren einer Intuition erkennbar, welche die gegenüber der für unmittelbar genommenen Alltagswelt [22] und den reflektierenden Medienwelten dritte Wirklichkeit[23] der tradierten religiösen und philosophischen Entwürfe mit dem Gedanken der Grenzüberschreitung verbindet, insbesondere, durch die englische Sprache erleichtert, der Grenzüberschreitung im ‘Raum’ sprachlicher und verwandter symbolischer Medien. Der transzendente ‘Himmel’ würde auf dem Wege dieser zwiefachen Umbildung zum Grenzbereich der als Autoritäten in Entscheidungen über Realität etablierten Medien der menschlichen Kultur umgedeutet, d. h. zum dem Feld menschlicher Aktivität, auf dem im präzisen Sinne kulturschöpferische Leistungen erbracht werden: dem Gebiet, in dem sich die als Ausgriffe in Symbolgestalten faßbaren Intentionen zu realen, als ‘erdgebundene’ Praxis existierenden Tendenzen erst noch umbilden müssen.Explorative Rationalität
Die Aufgabe philosophischer Konzeptbildung hinter den Grenzen zu vermuten, innerhalb deren liegt, was als aktualer Bestand von Kultur gelten kann, als die Gesamtheit der für zulässig oder nötig erachteten Gegenstandsbestimmungen und Verfahrensarten im Umgang mit Wirklichkeit, lenkt den Blick auf Voraussetzungen, deren Herkunft und Inhalt einer Erhellung wert wären [24]. Die einfache Wendung auf die Erfahrung, daß noch keine Form menschlichen Lebens von unendlicher Dauer gewesen ist, bemerkte den Fakt, aber der Verzicht auf dessen Erklärung machte Fragen nach möglichen Tendenzen des Wandels überflüssig. Mit ihm gäbe es keine exploratio jenseits aktueller Horizonte, sondern nur Fatalismus oder Gleichgültigkeit, die aus Resignation der Bedürfnisse angesichts einer für unzulänglich gehaltenen Ausstattung des Bedürftigen hervorgehen, oder aber eine gelassen freudige Erwartung alles Beliebigen, die den Glauben voraussetzte, nicht enttäuscht werden zu können. Der ‘Nihilismus’ vom Anfang des 20. Jahrhunderts wurde einmal treffend als die Erscheinung einer Erfahrung identifiziert, die eine allgemein resignierende Gebärde aus der Enttäuschung besonderer Erwartungen machte [25]. Der innere Zwiespalt des bürgerlichen Selbstverständnisses, Fortschritte der Daseinsvorsorge und Zivilität im Namen aller anzustreben und zugleich die Entsagung derjenigen fordern zu müssen, die dabei als Mittel verbraucht wurden, war hier zur Implosion gediehen. Die Furcht, daß die bis dahin mit dem Habitus der Bürgerlichkeit identifizierte Arbeit an der Versittlichung der Lebensbedingungen zugleich mit jenem unterginge, konnte sich als rhetorisch durchgebildete Apokalyptik alles Kulturlebens überhaupt plazieren, der die Enttäuschung am Versprechen Indiz für die Verfehltheit des ganzen bisherigen Weges war. Diesem Krisenbewußtsein konnte zudem sehr leicht ein älteres sekundieren, das schon weit länger Grund gehabt hatte, mit heftigem Affekt auf zerreißende Erfahrungen zu reagieren. Sie hatten für es im Verlust leiblich-rhythmischer und stimmungshafter Geborgenheit in ‘natürlich eingebetteten’ Lebens- und Arbeitsformen bestanden. Erst am Ende des 20. Jahrhunderts ließ sich mit Gelassenheit überblicken, daß der Untergang des Bauerntums als seit dem neolithischen Zeitalter quantitativ dominierender Schicht [26] nicht das Ende des ‘Natursinns’ des Menschen bedeutete, sondern nur das Ende einer fatalen Abhängigkeit, deren Reprise als ästhetische Inszenierung aber allein die Geste des Abschieds, keine Lösung für die Zukunft sein konnte. Heidegger mochte noch hoffen, der reaktive Affekt eines agrarischen Bewußtseins sei durch die ältesten Dokumente der Schriftkultur beglaubigt, aber das zeigte nur, daß er annahm, man müsse nach so langer kultureller Evolution erst recht wie Hesiod denken und die Weltgeschichte als Verfallsprozeß erkennen. Daß am Ende nichts als Das Nichts stünde, war dann nur konsequent gedacht. Wenn man aber Nihilismus weder als akzeptable Bewußtseinsform noch als unausweichliches Geschick ansah wie Günther [27], dem dieser vielmehr Aufforderung zum theoretischen Engagement bedeutete, mußte man den diagnostisch gemeinten Terminus entschieden umdeuten, wollte man nicht auf ihn verzichten. Daß die gesuchte transklassische Logik eine meontische sein sollte, weil die klassische eine auf Sein und Seiendes hin konzipierte, also ‘ontische’ sei, ist ein weiterer nominativer Versuch für sein an tentativ definierenden Termini nicht eben armes Unternehmen, der sich vom ersten systematischen Text bis zu den späten Schriften finden läßt [28]. Zwar nimmt er die Anregung durch Platon dafür in Anspruch [29], doch kann er innerhalb seines Konzepts nicht dessen Bestimmung als des Nicht-Seienden, das in gewisser Weise doch sei folgen, denn das hieße, es als die differentielle Relation der logischen Distinktion zu verstehen. Er nimmt konsequent realistisch orientierte Prämissen in Anspruch, indem er es als ein Nichtsein bestimmt, für das sogar der Ausdruck Noch-Nicht zu eng an die Bedeutung ‘Gegebenheit’ gebunden sei, da in diesem ein letzter sublimer Bezug auf Gewesenes unausgelöscht bleibe [30]. Das Nichts, um das es hier gehen soll, wäre daher etwa zu bestimmen als das: Niemals je zuvor.
Die Erläuterung, die dem Interpreten diese Deutung nahelegt, erscheint als die Verschärfung einer historistischen Norm. Die dem Seinsdenken unrettbar verfallene traditionelle Philosophie sei auch in der Gestalt eines Denkens noch präsent, das Gewesenes thematisiere, um ihm Unabgegoltenes abzugewinnen, unausgeführte Aufträge, die den Resultaten vergangener Kulturepochen möglicherweise noch einwohnten. Der ungerührte Schnitt, der statt dessen Zukunft von Vergangenheit trennt, ist als Folge der nicht explizierten Annahme plausibel, daß Resultate kultureller Akte im strengen Sinne immer Einsetzungen in einem Möglichkeitsfeld sind und nicht aus gegebenen Konstellationen emanieren. Davor läge die Unterstellung, Kultur sei überhaupt die Daseinsart jenseits stabiler Reiz-Reaktions-Kopplungen, für deren Fortsetzung nie auf gesicherte Bestände, sondern, noch unter dem Schein von Nachahmung, allein auf Erzeugung gebaut werden könne. Sie wäre die Konkretisierung der Kontingenzunterstellung, die hier theoretisch bewältigt werden soll, in Hinsicht auf die erfolgte Wendung zur Zukunft. Eine plausible Konsequenz des methodischen Vorsatzes, keinen Zustand der Kulturgeschichte als bloßen Durchgang zum nachfolgenden theoretisch zu funktionalisieren, wäre sie allerdings nur, wenn man die thematische Amputation für die einzig mögliche Operation angesichts eines unbewältigten theoretischen Problems ansieht. Es gibt nicht allein die bedeutsame sittliche Obligation, in vergangenem Leben mehr als nur den Zubringer gegenwärtiger Vervollkommnung zu sehen, weil auch bereits diese Ansicht an der Blindheit für die mit der enteignenden Geste zugestandene Implikation krankte, daß die Gegenwart auf den Resultaten der Vergangenheit aufbaut. Es gibt zudem inzwischen Einsichten, die das Interesse der historischen Wissenschaften für die durchaus nichtklassischen Problemstellungen in der Physik des deterministischen Chaos und ihrer mathematischen Modellierung weckten, da hier einiges wiederkehrte, was auf jenen Fachgebieten ungelöste theoretische Probleme darstellt [31]. Die für einen genetischen Kausalbegriff höchst folgenreiche Feststellung, man könne historische Entwicklungen auch dann nicht prospektiv konstruieren, wenn man sie retrospektiv rekonstruieren könne, deutet auf eine weit produktivere Konzeption, als es eine sein könnte, mit der aus der Unmöglichkeit eindeutiger Voraussagen bereits auf die Diskontinuität der Folge geschlossen wird. Günther erwähnt wiederholt die Formel Schellings, Sein sei ‘gewesene Freiheit’ [32], dringt aber trotz dieser inspirierten Problemfixierung nicht zur Einsicht durch, daß ein gegenwärtiger Zustand einer kulturellen Lebensform Potentiale nährt, die verschiedene, auch widerstreitende Tendenzen entbinden können. Daß nie alle Möglichkeiten im Folgezustand realisiert werden, trennte nicht radikal den vorausgegangenen vom gegenwärtigen Zustand, sondern bürge die theoretisch fruchtbare Fassung der Einsicht, daß auch die Vergangenheit nicht als nur schmalerer Vorläufer des Gegenwärtigen zu begreifen ist, also die zur Güntherschen komplementäre These. Für seine Akzentuierung, daß die Zukunft keine bloße Verlängerung des Gegenwärtigen sein kann, wo Akte willentlicher Setzung vollzogen werden, ist die Differenzierung plausibel, wenn auch in der abgeleiteten Vorstellung vom größeren Maßumfang [33] des den Potentialraum abgelebter Epochen immer überschreitenden der je aktuellen eine Irreführung steckt, die im Versuch enthalten ist, etwas zu quantifizieren, was sich nicht quantifizieren läßt: das Mehr an Möglichkeiten, den größeren Spielraum der Optionen.
Der Akzent verweist dennoch auf eine zinsträchtige Erbschaft. An den Skizzen zur theoretisch interessanten Konstellation ist die Absicht erkennbar, der Einsicht systematisch Recht zu verschaffen, daß es, auch ungeachtet unabgegoltener der Vergangenheit, immer beispiellose Möglichkeiten der Zukunft geben kann. Das ergäbe die Gestalt einer durch den Historismus hindurchgegangenen Fortschrittskonzeption, die es verdiente, ausführlich entfaltet zu werden. Günthers Bemühungen sind wohl von ihr gezeichnet, aber zu mehr als der unausgeführten und, recht besehen, in ihrem Kontext unmotivierten Behauptung, daß die Geschichte der Boden ist, auf dem sich eine metaphysische Differenzierung des Menschen vollzieht[34], gelangt er nicht. Wir haben hier ein weiteres Beispiel einer revolutionären Prämisse, die mit dem Programm einer modernen Philosophie intellektuelle Sprengkraft entwickeln müßte, aber nur als vergessener Zünder in ungeöffneten Tiefen verborgen bleibt. Wir dürfen vermuten, daß die Anregung zu dieser Präsupposition, wenn sie nicht sowieso dem Lehrer Paul Hofmann zu verdanken sein sollte, von diesem doch kaum beeinträchtigt, sondern eher befördert wurde, ziehen wir zum Vergleich noch einmal einen seiner Texte heran [35]. Die hier auffindbaren Formeln zur Rolle des Philosophierens korrespondieren auf eine so überraschend genaue Weise mit den Anstrengungen Günthers, der Philosophie ein neues organon für die Arbeit an den Rändern des etablierten Bestandes kultureller Definitionen zu schaffen, daß man die Hoffnung hegen dürfen wird, hier sei in erhellenden Wendungen ausgesagt, was die Forschungen auch des Schülers zu einer Logik der Erfindung und Erkundung antreibt. Hofmann formuliert wohl in der ersten Person Singular, doch in dem bereits früher zitierten Kontext, der die von Geisteswissenschaft und Philosophie erzeugten ‘Sinngebilde’ als Mittel zur Selbstverständigung einer Kulturgemeinschaft identifizierte. So läßt sich an Stelle des Pronomens Ich mit Gewinn Wir setzen, liest man die Wendungen: Die einseitige Geringschätzung des nicht Gegenstände bestimmenden und ‘Mittel’ suchenden, sondern sich selbst verstehenden und letzte Ziele ‘setzenden’ Erkennens oder Erkennenwollens beruht zweifellos auf der objektivistischen Blindheit des abendländischen Denkens .. Sie würde berechtigt sein, .. wenn ich in dem Wollen, das ich in mir spüre, auch ohne weiteres und in fragloser Klarheit schon wüßte, was ich ‘eigentlich’ will. Dieses Vorurteil ist aber falsch. Es ist in Wahrheit sehr schwer, es ist sogar eine unendliche Aufgabe der selbstbesinnlichen Erkenntnis, sich klarzumachen, wie ich ‘bin’, .. wie der Sinn meines Lebens und so vor allem der tiefste und echteste Sinn meines Willens adäquat ‘auszudrücken’ ist. Das Ausdrücken von Sinn aber vollzieht sich allgemein in ‘Sinnbildern’, in den Vorstellungen der möglichen .. Sachen, auf die das sinnbeseelte Wissen oder Wollen ‘angewandt’ werden kann .. In dem Entwerfen solcher auslegenden Vorstellungen versteht die ‘Freiheit’ sich selbst, und zugleich setzt sie sich die Ziele .. Es sind die sogenannten ‘Utopien’, welche dieser Aufgabe dienen wollen[36]. Daß zuletzt sogar dieser Terminus nicht vermieden wird, erinnert daran, daß in der so skizzierten Aufgabenstellung nicht nur enthalten ist, sich zu erklären, was man immer schon wolle, sondern auch, sich zu erschließen, was man wollen könne: was überhaupt wünschbar sei. Eine Vernunft, die so zu philosophieren entschlossen wäre, würde sich durchsichtig zu machen imstande sein, daß ihr ‘Vermögen der Regeln’ in seinem Kern ein ‘Vermögen der Zwecke’ ist, also den Konnex bewußt zum systematischen Prius zu machen, der zu Kants Prägung geführt hatte, daß der objektive Charakter einer theoretischen Ordnung ihre formale Zweckmäßigkeit sei.
Es ist ein langer, umwegiger und verschlungener Gang, auf dem man zum Zentrum der Philosophie Gotthard Günthers gelangt. Einmal angekommen auf dem beherrschenden Gipfel dieses zerklüfteten Gebirges an Gedanken, läßt er sich markieren: ‘Transklassische Logik’ [37] kann als der Inbegriff einer Gesamtheit gesuchter intellektueller Verfahren verstanden werden, mit denen in methodisch disziplinierter, rechenschaftsfähiger Weise erkundet werden soll, was wir wünschen können, um in Erfahrung zu bringen, was wir wollen dürfen. Daß Günther selbst im Fortgang seiner theoretischen Arbeit mehr und mehr dazu neigt, die transklassische Logik als die ‘Logik der Geschichte’ vorzustellen, verdankt sich erkenntnisrealistischen Prämissen, die noch darzustellen sind, verstellt aber doch nicht ganz, daß sie als ‘Logik’ zuerst ein Instrumentarium geschichtsphilosophischer Erörterung sein könnte. Hier zeigte sich dann ein Glanz, der auch die Aufmerksamkeit derer auf sich zu ziehen vermöchte, die geschichtsphilosophischem Denken skeptisch gegenüberstehen, doch bereit sind, die Möglichkeiten zu erkennen, die sich mit der Transformation dieses Typs von Philosophieren in eine Arbeit ergäben, deren Sinn in etwas liegt, woran uns Kant erinnert und woran sich auch in den Tagen des Historismus manche erinnerten: in ihrer Funktion als Appendix zur praktischen Philosophie, d. h. als Reflexion auf die gebotenen und realisierbaren Ziele menschlichen Handelns in weltgeschichtlicher Perspektive[38]. Es ist von eigener Bedeutung, daß die hier diskutierte Fassung dieses Programms von ihrem Autor auf einem Weg entworfen wird, der von der Diagnose konfligierender oder auch nur stumm und taub gegeneinander stehender Lebensformen ausging. Das offenbare Geheimnis, daß unvermittelbar einander gegenüberstehende Ansprüche, deren keiner eines Schuld begründenden Verstoßes gegen anerkannte Normen zu überführen ist, nur damit zum Ausgleich zu bringen sind, daß man eine Dimension öffnet, in dem das Intendierte einen Zuwachs an Konkretion und Relativierung erfährt und sich dann aufeinander beziehbar erweist, was in beschränktem Horizont unvereinbar schien, ist hier mit anhebendem Bewußtseins zum Zentrum der theoretischen Aufmerksamkeit geworden. Daß diese Leistung von den die Realität als factum brutum, das viel weniger als dieses begriffen denn als datum erlitten wird, überbietenden symbolzeugenden Operationen menschlichen Geistes abhängt, ist die Einsicht, die den basso continuo in der Partitur des Hauptwerkes ausmacht. Günthers Formel dafür hat den Stil einer Proklamation: Das Denken ist von höherer metaphysischer Mächtigkeit als das Sein[39].A ist nicht A
Logische Identität und Korrespondenztheorie
Die Formulierung ist in einer frühen Rezension zu Recht als vage und dem Begreifen kaum behilflich kritisiert worden [40], aber eine eingehende Rezeption anderer Texte Günthers und schon des Kontextes der betreffenden Stelle kann zur Erhellung beitragen. Die Formel wird in der Einleitung aufgestellt und verlangt vom Leser Geduld, denn eine Paraphrase der intuitionistischen Position im Grundlagenstreit der Mathematik, 115 Seiten später, liefert den Schlüssel zum Verständnis [41]. Hier wird erkennbar, daß der mathematische Terminus für das Maß eines Mengenumfangs in Anspruch genommen werden soll [42], was so naheliegend wie erklärungsbedürftig ist.
Die Erläuterung der intutionistischen Konzeption des Umgangs mit unendlichen Mengen oder transfiniten Mächtigkeiten akzentuiert die Unendlichkeit möglicher Distinktionen bei der konstruktiven Realisierung mathematischer Objekte auf einer unabgeschlossenen Menge. Hier wird der Begriff der potentiellen Unendlichkeit weniger in seiner spezifischen Differenz in Anspruch genommen als vielmehr als signum einer allgemeinen Konstellation an einem konkreten Beispiel. Hatte der Intuitionismus gefordert, kein mathematisches Objekt als existent zu unterstellen, für das nicht eine ‘effektiv realisierte’ Konstruktion gegeben werden könne, entdeckt Günther in der Konsequenz dieses Postulats einen Befund, den er für seine Theorie in Anspruch zu nehmen entschlossen ist. Ein jedes solches Verfahren sei eine Folge von konstruktiven Entscheidungen, so daß eine als realisiert identifizierte Folge eine sein müsse, die unendlich viele mögliche Schritte ausgeschlossen hatte, um definitiv sein zu können, was sie geworden war. Hier wird ein Problem der Mathematik zur gesuchten Illustration seiner Annahme, daß ein jeder distinktiver Akt, den man eine Prädikation nennen kann, in einer Unendlichkeit möglicher Alternativen ‘eingebettet’ ist. Seine Formel dafür enthält entscheidende Stichworte, die Opposition zur herkömmlichen Formalen Logik zu begründen: Dieses sich ins Unendliche teilende Schema möglicher Wahlformen aber ist nur ein Ausdruck dafür, daß die Reflexion sich im Kontinuumproblem nicht seinsthematisch erschöpfen kann. Es bleibt stets ein unbewältigter Reflexionsrest zurück, der in der klassischen identitätstheoretischen Abbildung des Denkens auf das Sein nicht aufgeht[43]. Das für die Unendlichkeit des Möglichen eingesetzte ‘Kontinuumproblem’ (sc. Kontinuum) steht hier für den von einer jeden verwirklichten Distinktion, jeder realisierten Prädikation X ist Y immer nur angerührten, doch nie ausgeschöpften Bereich des unbestimmten Potentials für ‘etwas von diesem’. Die Ungleichheit dieses Verhältnisses ist es, die in der klassischen identitätstheoretischen Abbildung des Denkens auf das Sein nicht aufgeht.
Hier wäre die Identität von Denken und Sein folgenreich umgedeutet, wenn auch nicht zweifelsfrei auszumachen ist, wie Günthers Argumente die theoretisch fruchtbare Behauptung zu rechtfertigen geeignet sind. Seine Wendung, Denken und Sein seien gemäß der Tradition metaphysisch voll identisch, weil sie empirisch kontradiktorisch sind[44], muß wohl auf die Erläuterungen zur Verwendung des Begriffs der Mächtigkeit einer Menge bezogen werden, um als eine sinnvolle Behauptung verstanden werden zu können. Sie bestünde darin, die identitätsphilosophische Generalthese als die Feststellung einer vollständig symmetrischen Entsprechung von ‘Denken’ und ‘Sein’ zu deuten. Die damit verknüpfte Substantialisierung der beiden Zentralbegriffe verspräche allerdings kaum eine nicht-traditionelle Logik und Metaphysik und in der polemischen Anwendung taugte sie allein zur Kennzeichnung einer Korrespondenztheorie der Wahrheit nach dem Muster der eidola-Lehre. Einer in toto eine ‘ältere’ genannten Tradition versucht der Autor tatsächlich diese Überzeugung der ‘Identität’ von Denken und Sein zuzuschreiben, und er scheut sich auch nicht, hier von ‘Isomorphie’ zu sprechen. Mehr als die undurchschaute Entlehnung eines mathematischen Terminius für die Einführung einer problematischen und unfruchtbaren These ist auch dies noch nicht [45]. Zudem ginge zwar die Diagnose einer ‘Isomorphie’ als einer Strukturanalogie oder sogar Strukturgleichheit über die Behauptung einer quantitativen Gleichheit hinaus, die aus den Konnotationen des Terminus Mächtigkeit abzuleiten wäre, aber beide enthielten doch nicht die Behauptung einer ‘Identität’. Daß zwei Bereiche identisch seien, weil sie ‘kontradiktorisch’ sind, ist auch bei Übersetzung des letzteren der Termini mit ‘symmetrisch’ oder ‘gleichmächtig’ nicht plausibel [46]. Erst, wenn man einem mehrfach wiederholten Verweis auf den Vortrag „Hegel und die Mathematik“ folgt, den Reinhold Baer auf dem Berliner Hegelkongreß 1931 gehalten hatte [47], lichtet sich immerhin das Dunkel der Herkunft dieser merkwürdigen These. Baer erläuterte die Konstruktion eines mathematischen Isomorphismus durch die Definition zweier Aussagensysteme, deren zweites alle Negate der Aussagen des ersten enthalte, das eine nur den Verknüpfungsoperator Konjunktion, das andere Disjunktion, beide den einstelligen Operator Negation. Diese mathematisch unfragwürdige Konstruktion wird allerdings von einer phantastisch anmutenden Deutung damit überholt, daß Baer in ihr die logistische Aufweisung der coincidentia oppositorum als einer Identität logischer Gegensätze gegeben zu haben glaubt [48]. Die illustrative Erläuterung an einem Beispiel aus der Mathematik, die überflüssigerweise mit dem imaginären Anteil Komplexer Zahlen zu bebildern sucht, was die Darstellung mit Ganzen auch geleistet hätte, bezeugt dabei aber nur, daß die Behauptung, die Trägermengen eines Isomorphismus seien nicht wesentlich verschieden und daher identisch, von der Voraussetzung getragen wird, zwei zueinander spiegelsymmetrische Gestalten seien ‘nicht wesentlich’ verschieden. Damit ist aber die Darstellung einer mathematischen Struktur auf undurchschaute Weise an ein Kriterium der Diskriminierbarkeit geknüpft worden, das nicht mathematisch definit, sondern allein anschaulich pragmatisch bestimmt ist. Ein solcher Begriff der Identität wäre einer präzisen Definition außerordentlich bedürftig, deckte er doch etwa auch die Behauptung, die typographischen Zeichen ‘<’ und ‘>’ seien identisch. Die Argumentation Baers aber wird von Günther in das Arsenal der eigenen aufgenommen und, nie kritisiert, jahrzehntelang verwendet [49]. Daß sogar die Formel gefunden wird, die absolute Identität von Denken und Sein sei die coincidentia oppositorum[50] ist für die Bedeutung der Baerschen Argumentation im Zentralpunkt der Güntherschen Theorie so erhellend, wie es für seine Thesen über ‘die’ Identitätsphilosophie ‘der’ Tradition fatal ist.Kritik des Zweiwertigkeitsprinzips
Die Diskussion dieses`problematischen Argumentationsgqnges müßte nicht so ausführlich`betrieben werden, läge hier nicht der Grund für Günthers Behauptung, Zeichen der Unzulänglichkeit der Aristotelischen Logik sei ihre Zweiwertigkeit. Alle identifzierbaren Versuche der Begründung enthalten nie andere als die Behauptung, symmetrische Dichotomie sei das Kennzeichen der überholungsbedürftigen Intellektualkultur. Günther konfundiert - man ist versucht zu sagen: systematisch - ‘Dichotomie’ oder ‘Dualität’ mit ‘Zweiwertigkeit’, ob als Identifikation oder verschwommen gedachte Spezifikation wird dabei nicht immer deutlich [51]. Keine von beiden Deutungen würde die Reformbedürftigkeit der Formalen Logik nach Aristoteles plausibel zu machen geeignet sein, und es gehört zu den Merkwürdigkeiten des Güntherschen Denkens, daß hier, wie oft im ganzen Werk, mit irreführenden und nicht überzeugenden Begründungen eine konstruktive Annahme zu rechtfertigen versucht wird, die erst in der Inanspruchnahme im Fortgang der Argumentation als eine, dann aber durchaus überzeugende, produktive Unterstellung begreifbar wird. Daß die Abweisung des Zweiwertigkeitsprinzips als Kritik des Identitätspostulats von Bedeutungen und Wahrheitswerten formuliert wird, weil, 1. Zweiwertigkeit ein Dualismus ist, 2. ein Dualismus eine Symmetrie sei [52], 3. Symmetrie Isomorphie und 4. Isomorphie Identität [53], beruht auf Begriffsverwirrung und einem Fehlschluß und ist weit eher geeignet, das Intendierte zu verdunkeln, als das Gesagte zu erhellen [54]. Die unduldsame Abfertigung, die Günther von manchem Kritiker erfahren hat [55], kann sich immer auf große Diskrepanzen in dessen Argumentation berufen, denn eine jede aufmerksame Rezeption wird immer wieder in die Irre geleitet: bildhaft schematisierendes Denken richtet die Probleme zu, arbeitet aber dabei mit Termini nicht-anschaulicher Gegenstandsrekonstruktion, was dann zu vage-abstrakten Beistellungen von separierbaren Problemstellungen führt. Seine Versuche, die Dichotomien von Inhalt und Form, Sein und Denken, Subjekt und Objekt etc. in toto für überholt zu erklären, gewinnen auch bei stärkster Sympathie des Interpreten für das Bemühen um die Auflösung verhärteter Frontstellungen in der Theoriebildung, mindestens hier, keine interpretierbare Fassung [56].Identität und Nicht-Identität
In welchem Sinne nun die Zweiwertigkeit der wahr/falsch-Unterscheidung zu überschreiten ist, wird an geeigneter Stelle noch zu erörtern sein. Hier ist vorerst von Interesse für den Fortgang der Darstellung, daß die Kritik des Satzes der logischen Identität, wenn sie auch nicht als die einer Isomorphie-Unterstellung begründbar ist, dennoch in einem nicht allzu überraschenden Sinne die Konsequenz einer Asymmetrie ist. Die als erwünschtes Hilfsmittel in Anspruch genommene Rekapitulation der intuitionistischen Prinzipien enthielt auch die Erläuterung, daß bestimmte Eigenschaften der als durch ein Gesetz ins Unendliche bestimmten Folge, die ein konkretes Objekt, hier eine Zahl, repräsentierte, bei einer im Fortgang der Folge erreichten Stelle bereits identifiziert werden könnten, ohne daß die Weiterentwicklung der Folge über diesen Punkt des Werdens hinaus, wie sie auch ausfallen möge, die Entscheidung wieder umstoßen kann[57]. Der uns interessierende Akzent liegt nicht auf der Unmöglichkeit, eine einmal konstruierte Eigenschaft eines symbolischen Objekts im Fortgang der Konstruktion wieder aufzuheben, sondern auf der mit der Erklärung eingeräumten Existenz des zu konstruierenden Objekts in zunehmenden Graden an Vollständigkeit. War erst die abgeschlossene Konstruktion die unzweideutige Präsenz des konstruierten Objekts, blieb zu fragen, was die unabgeschlossene vorstellte. Daß die Folge konstruktiver Akte eine ‘werdende’ genannt werden konnte, besagte, daß sie als noch nicht vollendete identifiziert war, was voraussetzte, daß sie auf das Resultat ihrer vollständigen Realisierung hin definiert wurde. Das Resultat konnte es als es selbst aber wiederum nur geben, wenn die Konstruktionsreihe aktual abgeschlossen war. Womit hatte man es nun an der Stelle zu tun, von der gesagt werden konnte: Von einer werdenden Wahlfolge können natürlich nur solche Eigenschaften sinnvollerweise ausgesagt werden, für welche die Entscheidung ja oder nein .. schon fällt, wenn man in der Folge bis zu einer [bestimmten] Stelle gekommen ist?[58] Die ‘unabgeschlossene’ Folge konnte als ein selbständiges Objekt gar nicht zum Bezug einer Erörterung gemacht werden, wenn man ihre Bedeutung nicht durch die Verweisung auf etwas konstituiert sah, was sie selbst nicht war: die abgeschlossene Folge. Es sind keine sophistischen Kniffe zu vermuten, behauptet man, in dieser Konstellation die Verletzung des Satzes der logischen Identität zu finden. Voraussetzung dafür ist allerdings, daß man sich nicht mit Etikettierungen aus einem Dilemma manövrierte, das einer auf die Disziplin strikter Bedeutungszuordnungen angewiesenen formallogischen Deskription zu schaffen machen muß, indem dem Namen unabgeschlossene Folge ein anderer Name, X, zugewiesen wird, um den eindeutigen Namen von einem für die abgeschlossene streng unterscheiden zu können. Man verstellte sich damit nur die Einsicht, daß der Name unabgeschlossene Folge eine eigentümliche Bedeutung hat, die konstitutiv auf etwas verweist, das es per definitionem noch nicht geben kann: das Resultat ihrer Vollendung. Die intuitionistische Verschärfung der Kriterien für die Existenz eines symbolischen Objekts in der unbedingten Bindung an die vollständige, restlos ausgeführte Prädikation all seiner Eigenschaften hatte hier dazu geführt, daß der proleptische Charakter solcher Objekte in den Fokus der Aufmerksamkeit geriet. Das, was die werdende Wahlfolge in jedem Abschnitt ihrer Realisierung war, konnte sie nur sein im Vorgriff auf etwas, das nicht existierte - wenn Existenz voraussetzte, daß das Objekt in effektiver Konstruktion realisiert zu sein hatte. Das, was sie war, war sie nur, indem sie auf etwas verwies, was sie erst noch werden sollte [59].A wird A. Einige Unterscheidungen
Einlösen einer Prolepsis
Unsere Interpretation akzentuiert so nicht zufällig den Vorgriff [60] als das einen naiven Identitätsbegriff destruierende Merkmal. Hans Friedrich Fulda verwies mit guten Grund darauf, daß der biographische Anstoß zur Entwicklung der dialektischen Methode in Hegels früher Auseinandersetzung mit der Erfahrung von mit ihren eigenen Normen in Konflikt stehenden Einrichtungen zu finden sei [61]. Übersetzte man diese ‘Normen’ in einen weniger legalistisch inspirierten Terminus, wären sie als die Erwartungen und Ansprüche an die Funktion der Institution erläuterbar, deren Erfüllung das vorausgesetzte telos dieser Institution ist, ihr Funktionssinn. Einem solchen zentralen Problemgrundriß - der dann andere konkrete Probleme gleichen Typs zu umfassen hatte, wie hier nicht en detail erörtert werden kann - hatte Hegel, wollte er ihn systematisch auszeichnen und eine ihm angemessene theoretische Rekonstruktion finden, ein Prinzip zu statuieren, das die spannungsreiche Dynamik von Anspruch und Erfüllung elementar und theoriestrategisch adäquat zu fassen erlaubte. Das Paradigma, das er fand, war der ‘spekulative Satz’. Voraussetzung für dessen Eigentümlichkeit, dynamische Vorgänge zu modellieren, ist Hegels Konzeption des Urteils, in der er die Problemkonstellation entfaltet, die nach Kant gegeben war. Dessen Auflösung der Substanz-Metaphysik enthielt auch die Konsequenz, Gegenstände der Bezugnahme nicht mehr nach dem Muster anschaulicher Ding-Vorstellungen zu denken, sondern rein als Bedeutungen, semantische Verweisungsfunktionen. Hegels strikt bedeutungsanalytische Untersuchungen mündeten folgerichtig in die Frage, was das Subjekt im Urteil eigentlich bezeichne, wenn es als vor der vollzogenen Prädikation stehend gedacht werde. Sie wurde eine von Dringlichkeit, unterstellte man, daß ein jeder Subjektterminus immer nur die durch die Gesamtheit all seiner Prädikate konstituierte Bedeutung haben konnte. Hier läßt sich als Auflösung des Dilemmas einsetzen, daß ein Subjekt im Urteil als prolepsis, als notwendig vager Vorgriff auftritt, der mit der Prädikation in unterschiedlicher Weise ‘erfüllt’ werden kann: Das Subjekt hat erst im Prädikate seine ausdrückliche Bestimmtheit und Inhalt; für sich ist es deswegen eine bloße Vorstellung oder ein leerer Name[62]. Die Hegelsche Unterscheidung der Urteile von Sätzen ist hier begründet. Mit dieser Konzeption hatte Hegel eine logische Modellierung für das Kernthema seiner Philosophie, die ‘sich selbst realisierende Idee’ gefunden. So, wie das Satzsubjekt als prolepsis ein ideeller Vorgriff, ist der Vollzug der Prädikation im Aussagen des Urteils ein Realisieren, wie der Leser Hegels wiederholt erläutert bekommt [63]. Die Formel von der Übereinstimmung eines Gegenstandes ‘mit sich selbst’, die außerhalb der Prämissen der dialektischen Geistphilosophie kaum anderes als sophistische Klügelei oder sinnleer wäre, hat in dieser Konzeption des Gegenstands einer philosophischen Semantik ihre Voraussetzung. Die Übereinstimmung wäre gewährleistet, wo der Vorgriff der Subjekt-Idee von der Prädikation-Realisierung vollständig eingelöst wird [64].
...Tertium datur
Überschreitung von Kontexten
Das beharrliche Streben Günthers, in der transklassischen Logik nicht nur eine neue ‘Theorie des Denkens’, sondern auch die Grundlagen eines Instrumentariums zu geben, das intellektuelle Vollzüge jenseits der von der traditionellen Logik definierten ermögliche, macht es nötig, für die kritische Rekonstruktion seines Theorieprogramms zuerst den Akzent auf die Interpretation alszu legen. Kants Bedenken, ein solches könnte in Ansehung der Spekulation nur die Hybris befördern, ein vollständiges System der Vernunft [65] schaffen zu wollen, muß bei diesem Nachfolger Hegels nicht genährt werden, da er kein vorhandenes System von Vernunft- operationen rekonstruieren, sondern Mittel der Überschreitung bisheriger Vernunft konstruieren will. Daß diese mit dem Verzicht auf die im Identitätspostulat gesicherten definierenden Funktionen eine ‘indizierende’ zu begründen geeignet sein sollen, macht die Aufnahme der intuitionistischen Kritik des Satzes Tertium non datur aus. Sie bezieht sich folgerichtig nicht auf den Problemaspekt, der mit der Suspendierung der Identitätsforderung im Begriff der werdenden Wahlfolge für die Aufhebung des Tertium non datur schon gegeben ist, sondern folgt den Argumenten der Intuitionisten in einem anderen: der ‘Imprädikabilität’ eines beliebigen Attributs für solche Gegenstände, die nicht ‘effektiv konstruiert’, d. h. definitiv gegeben sind. Innermathematisch bedeutete diese Forderung, daß der bisher unproblematisch unterstellte Existenzbegriff eine präzisere Neufassung erhalten sollte: für existent war ein mathematisches Objekt nur noch zu halten, wenn es mit den konstruktiven Mitteln der Struktur erzeugbar war, der es unter Wahrung innerstruktureller Homogenitätskriterien zugehören sollte, nicht mehr durch die intuitiv selbstverständliche Möglichkeit, seine Existenz anzunehmen und die Konsequenzen daraus zu entwickeln [66]. Diese Nuance mochte in der Mathematik umstritten bleiben, vor allem ihrer schwer erträglichen eliminatorischen Folgen für ganze bis dahin solide gesicherte Gebiete wegen [67], doch sie konnte die Aufmerksamkeit eines Theoretikers fesseln, der zu fragen hatte, was die ‘Existenz’ eines nicht-empirischen, rein symbolischen Objekts ausmachte. Die nun naive Praxis der vorintuitionistischen Mathematik konnte nach Brouwers Kritik durchaus als Beispiel einer unbedachten Willkür erscheinen, der eine Hypothese über Existenz ausreichte, um das Faktum anzunehmen. Der neue Ansatz bedeutete demgegenüber, den expliziten Nachweis der Erfüllung- der von axiomatischen und abgeleiteten Sätzen über einen Gegenstandsbereich explizit und implizit gesetzten Bedingungen für die Existenz innerhalb seiner zu fordern.
Günther führt in diesem Aspekt allerdings in die Irre, wenn er formuliert: Für die bereits vollzogenen Wahlakte und die durch sie erzeugten Zahlen gilt der Satz vom ausgeschlossenen Dritten. Für die noch in der Zukunft liegenden Wahlfolgen ist er suspendiert [68]. Der Zeitterminus transponiert das logische Problem auf eine Ebene, auf der es verschwindet, da diese nicht die logischer Relationen ist, sondern von ‘Tatsachenordnungen’. Aber nicht die Tatsachen stehen in logischer Relation zueinander, sondern nur die Sachverhalte, die in Sätzen ausgesagt werden. Keine conclusio kann die Ableitung einer Tatsache sein - immer nur die Behauptung ihrer ‘Gegebenheit’. Daß hier keine Klarheit herrscht, prägt folgerichtig auch Günthers Retraktation der Diskussion aus dem 9. Kapitel von „Peri hermeneias“, in der er zu der Unterscheidung zwischen zeitloser Gültigkeit und zeitbeschränkter Anwendung eines logischen Gesetzes gelangt [69]. Ein Gesetz, das auch dann noch gültig sein soll, wenn es nicht ‘angewendet’ wird, kann nur als quasi-platonistische Wesenheit gedacht sein, da Geltung die normative Wirksamkeit für Handlungen besagen muß, die vorausschauende Orientierung an ihm auslöst. Soll ein Gesetz zwar gelten, aber nicht anwendbar sein, ist es als normativ wirksam gedacht, ohne in actu wirken zu können.
Daß über die Behauptung, morgen finde eine Seeschlacht statt, keine Beurteilung wahr oder falsch abgegeben werden kann, ist zudem nur scheinbar ein ‘Zeitproblem’, tatsächlich jedoch nichts anderes als ein weiterer Fall von Imprädikabilität: es müßte erst außerhalb der Satzebene eine Prüfung auf die Tatsächlichkeit des behaupteten Sachverhaltes möglich sein, etwa durch Augenschein, um entscheiden zu können, daß der ihn aussagende Satz wahr oder falsch sei. Wie wenig dies das Problem einer innerlogischen Zeitlichkeit ist, sollte die Erinnerung an die vorläufige Unentscheidbarkeit einer Behauptung wie ‘Roosevelt schlief am 8.12.41 nur zwei Stunden’ illustrieren können. Der Versuch, die Bewertung dieser Aussage als von der Zeit abhängig zu beschreiben, müßte den Umstand übersehen, daß nicht ‘die Zeit’, sondern allein ein Interesse an konkreter Nachforschung und deren Erfolg die Bedingungen für Entscheidbarkeit zu erfüllen Ursache sein könnten. Weder Zeit noch Interesse, noch auch Archivstudien aber sind in der Ebene des Logischen ‘sichtbar’, hier gibt es nur wahre und falsche Sätze, wenn auch vielleicht solche über Zeit, Interessen oder Arbeitshandlungen. Daß Günther hofft, ein weiteres Argument für die Gültigkeit des Satzes vom ausgeschlossenen Dritten auch für die Zeitdimension[70] anführen zu können, ist daher überflüssiges Bemühen [71].
Von ganz andere Konsequenz ist die Akzentuierung, erläutert man den Unterschied der bereits vollzogenen Wahlakte und der noch in der Zukunft liegenden als den zwischen definit gegebenen und unbestimmt möglichen. Warum der Satz vom ausgeschlossenen Dritten für jene gilt, aber nicht für diese, läßt sich dann in Einklang mit der Praxis der überwiegenden Zahl der Logiker erklären. Die drei Prinzipiensätze von der ‘Identität’, vom ‘ausgeschlossenen Dritten’, und vom ‘verbotenen Widerspruch’ sind kaum einmal Thema der Logikdiskussion, da sie vorausgesetzt werden müssen, um sinnvoll Forschungen unter dem Titel einer ‘Logik der Sprachregeln’ oder dergleichen unternehmen zu können. Sie sind hier von ähnlicher Selbstverständlichkeit wie die Existenz von ‘Materie’ für die Physik, das Phänomen des ‘Lebens’ für die Biologie und die Gegebenheit nicht-natürlicher Phänomene für die Kulturwissenschaften. In der Formalen Logik sind die genannten Sätze Postulate, die die Eindeutigkeit der Zeichen-Bedeutung-Zuordnung aussagen. Da diese die elementare Voraussetzung für Formale Logik ist, können die Postulate dann folgerichtig auch als Tautologien innerhalb von Kalkülen der Aussagenlogik eingesetzt werden. Wo diese Tautologien nicht gelten, wird somit die Eindeutigkeit der Zeichen-Bedeutung-Zuordnung bestritten. Das heißt, hier würde zugelassen, was in der Formalen Logik zur quaternio terminorum, zum Fehler in den Prämissen und anderen klassischen Fehlern führt: die Veränderung der Bedeutung eines Zeichen innerhalb eines Anwendungskontextes, meist, indem nicht eine definite Bedeutung durch eine andere derselben Art ersetzt wird, sondern eine vage fortschreitend präzisiert. Man könnte den Satz der logischen Identität das Prinzip der Bedeutungskonstanz nennen, den Satz vom ausgeschlossenen Dritten das der zureichenden Bestimmung und den Satz vom verbotenen Widerspruch das der präzisen Distinktion. Daß die formalen Notationen dieser Sätze,[72] ineinander umgeformt werden können, ist Indiz dafür, daß ihr funktionaler Sinn ein und derselbe ist [73], den man auch als das principium rationis sufficientis aussprechen kann, versteht man darunter die ganz unmetaphysisch gedachte vollständige logische Determination [74]. Daß diese außerhalb von scharf begrenzten Aussagsystemen noch nie und nirgends fraglos und endgültig geleistet worden ist, ist der Stachel der Kontingenz im Fleisch der Kultur.
Die Beunruhigung, die Fälle möglicher Ungültigkeit des Satzes vom ausgeschlossenen Dritten unter Logikern auslösten, führte etwa Lukasiewicz zu umwegigen Überlegungen, die bis zum Vorschlag einer dreiwertigen Logik reichten [75]. Das hier neu eingeführte ‘Bivalenzprinzip’ wurde als Ergänzung zum Tertium non datur konzipiert, worin sich immerhin die Intuition zeigt, daß dieses nicht hinreichend ist, die Auflösung einer Unentscheidbarkeit durch Einführung eines dritten Wertes zu erzwingen. Die Einführung geht wohl aus dem Konflikt hervor, einen ‘unbewerteten’ Satz nicht akzeptieren zu wollen, was hieße, ihn aus der Formalen Logik auszuschließen, zugleich aber diesen Ausschluß nicht hinzunehmen. Resultat ist die contradictio in subiecto, ‘unbewertet’ als dritten ‘Wert’ einzuführen [76]. So wird mit den Mitteln der Formalen Logik einer Gefahr zu begegnen versucht, die erst mit der Annahme entsteht, daß alle überhaupt akzeptablen Satzaussprüche ‘wahrheitsdefinit’ seien. Die Entwicklung der logischen Differenzierungskultur hat inzwischen die produktiven Versuche Paul Lorenzens hervorgebracht, angeregt durch Aufgabenstellungen der intuitionistischen Theorieströmungen, ‘wahrheitsdefinite’ von ‘beweisdefiniten’ Aussagen zu unterscheiden, also Aussagen, deren Wahrheitswert definitiv bestimmt ist von solchen, für die nur Verfahren zur möglichen Feststellung des Wahrheitswertes gegeben werden können [77]. Es ist produktiver und ökonomischer, anzunehmen, daß die für eine wahrheitsdefinite Aussagenlogik unbestreitbaren Prinzipiensätze, wie der vom ausgeschlossenen Dritten, implizit sanktionieren, daß ‘Aussage’ im Sinne der Logik nur eine Satz sein kann, über dessen Wahrheit oder Falschheit definitiv entschieden ist [78]. Manchen Definitionen eignet die schlichte Eleganz, alle anderen Sätze gar nicht erst als Aussagen im Sinne der Logik anzuerkennen, mithin als für die Aussagenlogik ‘nicht existente’ auszuschließen. Daß die Notifizierung als ‘im Sinne der Formalen Logik vorhanden’ nicht die notwendige Bedingung für die Existenz eines Behauptungssatzes überhaupt ist, sollte die Erinnerung bestätigen können, daß manche pragmatisch sinnvollen Sätze solche ohne oder noch ohne eindeutige Wahrheitswertbelegung sind. Das Phänomen der self fulfilling prophecy etwa wird sich kaum mit Instrumenten der Logik rekonstruieren lassen, daß aber die hier erscheinenden Behauptungssätze somit ‘bedeutungsleer’ seien, wird dennoch nicht überzeugend zu belegen sein [79].
Günther hat, wenn auch kein hinreichend präzises Bewußtsein, so doch die fruchtbare Ahnung, daß hier die aktuelle Form der Aufgabe der Philosophie liegt: über den Fortgang der historischen Drift von Bedeutungen methodisch Rechenschaft zu geben, um sich über Stand und Aussichten der Gegenwart einer Kulturgemeinschaft, nun sogar: der Menschheit, verständigen zu können. Wie wenig Grund besteht, anzunehmen, es werde in der kommunikativen Praxis je zu einer abgeschlossenen und zugleich pragmatisch nutzbaren Bedeutungsbestimmung systematischer Begriffe und darauf ruhender Aussagen kommen, läßt sich beispielhaft dem auf die endgültige Vollendung der naturwissenschaftlichen Verfahrensrationalität hoffenden positivistischen Selbstbewußtsein an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert ablesen. Wiederum Ernst Cassirer hatte es verstanden, hier am Beispiel des Äther-Begriffs der Physik in Erinnerung zu rufen, wie der Sündenfall der Verletzung logischer Prinzipien mitten in einer ihrer Rationalität völlig sicheren Wissenskultur auftreten konnte, ohne daß wohlfeile Aufforderungen zu disziplinierter Definitionspraxis Abhilfe zu schaffen vermocht hätten [80]. Nicht zufällige Ergebnisse, sondern der konsequente Ausbau der Äthervorstellung hatte zur Aufhebung eben dieser Vorstellung geführt[81] - sie erzeugte ein hölzernes Eisen, das erst mit dem neuen Begriff des ‘Feldes’ aufgegeben werden konnte [82].
Gotthard Günther führt ein Beispiel für die Verletzung des Satzes vom ausgeschlossenen Dritten an, das äußerster Abstraktheit und der Stellung in einem explikationsschwachen Kontext wegen bei ihm nicht recht zur Geltung kommt, hier aber, nach dem rekapitulierten geschichtsträchtigen, vielleicht doch: Es gebe vor Gericht den Fall, daß einem Angeklagten wohl die Tat eindeutig nachgewiesen werden könne, er darum schuldig zu sprechen wäre, dies aber dennoch nicht geschehe, obwohl sich nicht behaupten lasse, daß er unschuldig sei: den Fall, daß der Angeklagte nicht schuldfähig und der Psychiatrie zu überstellen sei. Innerhalb der Urteilskriterien der Jurisprudenz liege mithin eine Verletzung des Prinzips Tertium non datur vor [83]. Die bloße Erwähnung dieser Skizze eines Beispiels mag eher verdecken als ins Licht rücken, daß hier die Fähigkeit des Intellekts illustriert werden soll, jenseits der für selbstverständlich, weil konventionell in Anspruch genommenen Beurteilungskriterien eine völlig neue Dimension der Qualifikation des Falles zu eröffnen. Das Beispiel muß zumal deswegen unbefriedigend bleiben, da hier eine bereits etablierte Praxis des ‘Kontextwechsels’ geschildert erscheint, an der die besondere Pointe eines nicht-empirisch Gegebenes statuierenden Denkens nicht zur Wirkung kommt. Das wissenschaftsgeschichtliche Beispiel verweist mit größerer Prägnanz auf das, was bei der Verweigerung einer erwartbaren Qualifikation oder in der Sackgasse von antinomischen im Raum der symbolischen Ordnungen von Unterscheidungs- und Bewertungshandlungen vollzogen werden muß: die Erweiterung dieses ‘Raumes’, mindestens die Reorganisation oder eine fortschreitende Differenzierung von Unterscheidungsmöglichkeiten. Am Prozeß der Wissenschaftsgeschichte, zumal in der Günther prägenden Epoche, läßt sich heute erkennen, wie immer neue theoretische ‘Hinsichten’ erzeugt wurden, um einmal aufgetretene Probleme, die Verletzungen der Ordnungsprinzipien symbolischer Felder darstellten, zu bewältigen. Werner Heisenberg, der in der Physik des 20. Jahrhunderts nicht nur an einer umwälzenden innovativen Phase dieser Wissenschaft teilhatte, sondern selbst einen singulären Beitrag zu einem wesentlichen Fortschritt zu leisten vermochte, konnte knapp und exemplarisch formulieren: Im Grunde bedeutet ja die Entdeckung eines neuen Begriffssystems nichts anderes als die Entdeckung einer neuen Denkmöglichkeit, die als solche niemals rückgängig gemacht werden kann[84].Transformieren, Transponieren - Transzendieren
Günthers Erläuterungen des Übergangs zu anderen Bestimmungssystemen lassen sich nun leichter als Allegorie denn als Teil systematischer Rekonstruktion des symbolzeugende Arbeit auslösenden Problembewußtseins verstehen, dem als gewichtigstes Charakteristikum die Erfahrung der Kollision von Geltungsansprüchen zugehört. Allerdings verlangt dies, interpretatorische Sprünge zu wagen, deren Erfolge nicht in der Passung mit zitablen Stellen des interpretierten Autors, sondern allein in einer weiträumigen Ausleuchtung eines geistigen Raumes liegen, in dem sich im Werk auffindbare Spuren zu Mustern verbinden können.
Zu diesen Spuren gehört die Insistenz, mit der Günther der transklassischen als einer ‘zweiten’ Logik Objekte als Thema zuzuordnen sucht, die nicht zum Seinsthema gehörten. Seine Differenztermini sind: bona-fide-Objekte und Pseudoobjekte[85], die kompakt-dingliche Objekte von anderen unterscheidbar machen sollen. Die wenig erläuterte Aufzählung, zu letzteren gehörten der Pegasus, das Du, die Gravitation[86], ließe den Interpreten recht ratlos, welcher der kleinste gemeinsame Nenner dieser Stichworte sein könnte, suchte er ihre besondere Qualität nicht in eben der Absetzung von bona-fide-Objekten. Die Erinnerung an Paul Hofmanns ‘Sinnbilder’ scheint am Rande auf, erweist sich aber als zu schwach konturiert, da weder Du noch Gravitation den mindesten Bildcharakter aufweisen, wenngleich damit eine Deutung induziert ist, die reiche Anregung verspricht. War es bei Hofmann ‘objektivistische Blindheit’ des abendländischen Denkens, wird die Fortführung einer Aufgabenbearbeitung darin erkennbar, daß es für Günther eine überholungsbedürftige Seinsfixiertheit des - ‘klassischen’ - europäischen Denkens gibt. Daß das kontrastive nun ein Denken des ‘Nichts’ sei, verdankt sich der Befruchtung durch Hegels durchgängige Arbeit mit der metaphorischen und analytischen Potenz der Wortfamilien des ‘Nichts’ und des ‘Negativen’ [87]. Der knappe, doch perpetuierte Rekurs auf das Kategorienpaar Sein und Nichts vom Anfang der „Wissenschaft der Logik“ führt allerdings ebenfalls auf subtile Weise in die Irre, erhofft man sich eine Erläuterung der Kategorie Nichts nach der Analogie der Gegenüberstellung bei Hegel. Die Übersetzung als ein Titelwort für die negative Prädikation, gewissermaßen als der Verweis auf das Urteilsrudiment ‘ .. ist nicht ..’. [88], müßte eine nicht nur von Günther erprobte Funktionalisierung des limitativen Urteils heranziehen [89], um der Konfrontation eine interpretatorisch erhellende Leistung abgewinnen zu können. Ein unendlich-negatives Prädikat, etwa nicht-rot, wird auch von ihm als semantischer Verweis nicht nur auf alle Farben außer rot bezogen, sondern auf alle sonst überhaupt möglichen Prädikate weshalb das negative Prädikat ‘nicht-rot’ so inkommensurable Termini wie ‘gelb’, ‘dornig’ oder ‘duftend’ einschließt[90]. Die Anregung dazu entstammt ersichtlich Hegels Verfahren bei der Destruktion der Ding-Eigenschafts-Metaphysik des anschaulich vorstellenden common sense[91], das demonstrierte, wie in ihr unter dem Schein einer selbstverständlich plausiblen und konsistenten Vorstellung nur eine lose Agglomeration von Prädikataufzählungen ausgesagt werden konnte. Die Funktion des unendlich-negativen Prädikats ist bei Günther dennoch eine andere, die wiederum zwei kaum merkliche Verschiebungen voraussetzt, um leisten zu können, was sie soll. Wollte man den Fall einer Verletzung des Tertium non datur modellieren, hatte man nicht das unendlich-negative Prädikat, sondern nur das übliche negative einzusetzen, um einen Fall von Imprädikabilität zu demonstrieren: weder ist wahr, zu sagen, Die Zahl Fünf ist rot, noch, Die Zahl Fünf ist nicht rot, wenn man auch mit dieser, nicht nur jener Behauptung die erwartbare Präsupposition verbände, der Zahl Fünf sei überhaupt ein Attribut der Farbigkeit zu prädizieren. Damit ließe sich allerdings nicht verknüpfen, daß ‘nicht rot’ solche Prädikate wie ‘duftend’, ‘dornig’ usw. einschließen könnte und in der Tat präzis formallogisch auch einschließt[92]. Einzig die Deutung der negativen Prädikation als Bejahung eines unendlich-negativen Prädikats ergäbe dies - nur daß dann von einer Verletzung des Tertium non datur nicht mehr die Rede sein könnte.
Hier liegt an einem entscheidenden Punkt der Kristallisation des Themas noch immer eine Unfertigkeit. Der einfache, unentwickelte Verweis auf die negative oder aber die limitative Prädikation erschließt dem theoretischen Blick die Aufgabe. Die Unterscheidung beider Urteile hat nicht zwanglos selbstverständlichen Sinn, weshalb in der mathematischen Logik des 20. Jahrhunderts die Auffassung verbreitet ist, daß die Differenz unerheblich sei [93]. Nicolai Hartmann hingegen hat in seiner Erkenntnistheorie daran erinnern können, welche bedeutende Rolle limitative Prädikate im philosophischen Denken immer spielten. Prädikate wie Unendlichkeit oder Unsterblichkeit hätten immer ihre Funktion darin gehabt, den theoretischen Blick zu orientieren und vorläufig einzugrenzen, was noch nicht definitiv zu fassen war [94]. Der Kontext zeigt, daß auch Hartmann dabei ein methodologisches Bewußtsein von der Besonderheit philosophischer Theoriebildung voraussetzt, denn in eben dem Sinne, in dem von uns der Philosophie explorative Rationalität zugeordnet wurde [95], erkennt Hartmann die zentrale Funktion einer projektiven Begriffsbildung in der Ontologie. In Abgrenzung dazu, läßt sich erläutern, hat die an mathematisierten Theorien der operativen Rationalitätsform orientierte Formale Logik immer mit definitiven Begriffen zu arbeiten. Hier ist der Unterschied von ‘non A’ und ‘non-A’ tatsächlich unerheblich.
Erkennbar ist dann, daß Günther diese formallogisch nicht erfaßbare Differenz zu thematisieren hatte, sollte die Logik der Überschreitung gegebener Bedeutungsrahmen Gestalt gewinnen. Schritte in die richtige Richtung wären etwa dort getan, wo die Dichotomie sterblich-unsterblich darin überschritten würde, daß man dem möglichen Subjekt zu diesen Prädikaten jede Beurteilbarkeit nach Analogie empirisch-biologischen ‘Lebens’ abspräche. Dann könnte auch nicht mehr vermutet werden, unsterblich hieße zeitlich unbeschränkt lebend und es würde sichtbar, daß, genau genommen, weder sterblich noch unsterblich prädizierbar wäre. Günthers Versuch aber, hier eine noch nicht systematisch rekonstruierte intellektuelle Operation des ‘Wechsels’ zwischen disparaten Prädikaten zu identifizieren, ist mit den gegebenen Überlegungen kaum erfolgversprechend. Um des erwünschten Erfolges willen wird dazu riskiert, den fruchtbaren Gedanken von der ‘höheren metapysischen Mächtigkeit’ zu verdunkeln. Der Anschluß an die intuitionistische Kritik des Tertium non datur hatte ein Paradigma für die systematische Fassung der Unentscheidbarkeit mangels definitiver Existenz des Urteilssubjekts sein sollen, also eines besonderen Falles von Imprädikabilität: den Mangel expliziter Anwendbarkeit eines Prädikats aus Unkenntnis über die Beschaffenheit des Subjekts. Der diskutierte hingegen setzt die Kenntnis der ‘Eigenschaften’ des Subjekts für die Entscheidung über die gezeigte besondere Imprädikabilität voraus.
Daß zuletzt ein Moment der intuitionistischen Argumentation mit dem an dieser ursprünglich nicht abgeleiteten letzteren zum eigentlich intendierten Gedanken des Hinausgehens über definite Rahmen von Beurteilungskriterien verschmolzen wird, ist nun aber erwartbar: Wenn wir das Urteil fällen: die Rose ist rot, so haben wir ein relatives Prädikat gebraucht, das das volle Sein des Gegenstandes nicht erschöpft. Wir haben also das Recht, von hier zu ergänzenden und erweiterten Bestimmungsgesichtspunkten überzugehen. D. h., die Reflexion hat die Macht, die ursprüngliche Alternative zu verwerfen. Das ist in dem zweideutigen Terminus ‘nicht-rot’ impliziert[96]. [Also ist] ein Drittes in der Tat nicht ausgeschlossen. Es [besteht] .. in der Fähigkeit der Reflexion, sich mit der jeweiligen Alternative nicht zufriedenzugeben und über sie im Denken hinausgehen zu können. Das [ist] .. das geheimnisvolle Dritte.[97] Günther wird für die intellektuelle Operation, mit der Konstellationen der Imprädikabilität, oder, ließe sich ergänzen, auch kontradiktorischer Geltungsansprüche, überschritten werden sollen, später die Termini Rejektion und Transjunktion bilden [98]. Der erste hat nicht mehr zu bezeichnen als die ‘Verwerfung’ oder ‘Zurückweisung’ [99], etwa der sinnleeren Alternative, die Zahl Fünf sei entweder rot oder nicht rot (sondern andersfarbig), der zweite soll benennen, was als Problem erst durch die mit ihm als Namen prominent gemachte Lösung auffällig wird: die vorläufig enttäuschte Intention auf die prädikative Identifizierung eines Sachverhaltsmomentes erzwingt einen neuen Kontext definiter Beurteilungskriterien, wo alle verfügbaren unzureichend sind. Daß der Terminus nach der Analogie von Disjunktion und Konjunktion gebildet ist, verdeckt, daß in ihm der Akzent einer transpositio oder transitio herausgestellt werden soll, nicht der einer iunctio. In einem späten Text wird, was hier tastend erkundet wurde, mit Nachdruck erweitert: Die Alternative, um die es bei jenem mysteriösen Dritten ganz ausschließlich geht, ist die zwischen Sein-überhaupt und Nichts. D. h., hier ist mit einer Alternative zu rechnen, die so weltumspannend ist, daß kein übergeordneter Bestimmungsgesichtspunkt mehr benannt werden kann .. [100].
Ein Verfahren, mit dem eine weltumspannende Ordnung noch überboten werden kann, muß Aufmerksamkeit auf sich ziehen.Das fünfte Kapitel, das wir hier bedauerlicherweise nicht mehr publizieren können, soll die „Operatoren der Grenzüberschreitung“ darstellen und interpretieren, wofür exemplarisch die „Stellenwertlogik“, die „Kontextwertlogik“, die „Morphogrammatik“ und die „Proömialrelation“ ausgewählt wurden. Diese Texte finden Sie in der angebotenen Printversion.
Fußnoten
[1] Gotthard Günther: Selbstdarstellung im Spiegel Amerikas, in: L. J. Pongratz ed., Philosophie in Selbstdarstellungen, Bd. II, Hamburg: Meiner, 1975; pp. 25f. - Zum Schlagwort geprägt wurde der Terminus von Frederick Jackson Turner im 19. Jahrhundert, cf. id.: Die Grenze. Ihre Bedeutung in der amerikanischen Geschichte, Bremen: Dorn, 1947.
[2] Selbstdarstellung, l. c., p. 68.
[3] ibid. p. 21.
[4] Norbert Wiener notiert 1954 als eine Selbstverständlichkeit, daß „für den Durchschnittsamerikaner .. Fortschritt die Gewinnung des Westens, die Anarchie der Grenze“ bedeute, und akzentuiert den Zug daran, der uns hier bedeutsam scheint: „Lange Jahre vollzog sich die Entwicklung der Vereinigten Staaten vor dem Hintergrund eines leeren Landes, das immer weiter nach Westen rückte.“ - Mensch und Menschmaschine, Bonn: Athenäum, 3. A. 1966, p. 40.
[5] „[Der abendländische Mensch] war ausgezogen, die Welt sich untertan zu machen. Seine eigene Technik aber läßt ihm auf der kleingewordenen Erde anscheinend keinen Weg mehr ins unbetretene Freie“; in: Abschied von der bisherigen Geschichte, Leiden: Sijthoff’s, 1935, p. 392. - Für die Gegenwart etwa Eric Hobsbawm, Das Zeitalter der Extreme, München: dtv, 1998; 10. Kapitel: Die soziale Revolution, pp. 363-401.
[6] Wie auch die technisierte Kriegführung mit ihren, sogar im Vergleich zum ersten Weltkrieg (dem primären Schock für die europäische Kultur) grenzsprengenden Dimensionen in Raum und Zeit und das ungeheuere Ausmaß, welche die nazistischen Untaten durch Einsatz moderner Technologie und Planungsrationalität annehmen konnte.
[7] Hobsbawm findet beim Rückblick ein prägnantes Exempel für die Geschwindigkeit der jüngeren Wandlungsprozesse: „Die Veränderungen fanden tatsächlich in einer solchen Geschwindigkeit statt, daß die historischen Intervalle immer kürzer wurden. .. Ende der siebziger Jahre rechneten die Gemüseverkäufer auf den Marktplätzen mexikanischer Dörfer ihre Preise auf kleinen, japanischen Taschenrechnern aus, von deren Existenz zu Beginn des Jahrzehnts in dieser Gegend noch kein Mensch etwas gehört hatte“ (l. sub [5] c., p. 365). - Eine mögliche tiefe Auslotung der Folgen dieser Erfahrungen liegt natürlich bereits, mit anderen Akzenten und anderen Resultaten, in Hans Blumenbergs Lebenszeit und Weltzeit vor (Frf./M.: Suhrkamp, 3. A. 1986, bsd. pp. 260-262).
[8] Für die Anregung zu dieser Konjektur ist der Interpret Christian Meier verpflichtet, der in seinem lehrreichen Text über Die politische Kunst der griechischen Tragödie (Dresden: Kunst, 1989) darzustellen vermochte, daß die Athener des 5. Jh. v. Chr. nach der radikalen innenpolitischen Wende zur Isonomie und dem überraschenden Sieg über die östliche Großmacht „einen Wandel in anthropologischer Dimension“ durchmachten (p. 19). Ein damit verbundenes außerordentliches neues ‘Könnens-Bewußtsein’ habe hier die Frage danach provoziert, was „überhaupt Recht sei“ (p. 39) und wie weit „ein willkürlich gesetztes Recht wirklich verpflichte“ (p. 41). Die für uns bedeutsame Pointe liegt in der These, „mangels Deckung in einem Weltbild“ sei mit der attischen Tragödie ein neues Medium der Erörterung solcher Elementarfragen entstanden. Daß die kulturelle Funktion der science fiction nach dieser Analogie gedeutet werden könne, ist durch Meiers diagnostische Formel für die athenische Problemlage angeregt, die wörtlich zur Beschreibung der Erfahrungen im 20. Jahrhundert anwendbar ist: „Was herkömmlich die Wirklichkeit auszumachen schien, wurde weithin außer Kraft gesetzt. Statt dessen wucherten die Möglichkeiten und deren Grenzen waren nicht so bald erprobt. Es geschah ein Umbruch sondergleichen“ (p. 14). - Martin Schwonke, Schüler Helmut Plessners, hat in einem bemerkenswerten Text der Göttinger Abhandlungen zur Soziologie die Entwicklung Vom Staatsroman zur Science Fiction verfolgt (Stuttgart: Enke, 1957). Hier liegt eine sozialwissenschaftlich inspirierte Bekräftigung für die Stichhaltigkeit unserer Vermutung vor, da Schwonke zu zeigen vermag, wie sich mit den Staatsutopien, dann den phantastischen Erzählungen des 18. Jahrhunderts und schließlich in der science fiction ein Typus von Literatur entwickelt, in dem die „Intention auf ‘andere Möglichkeiten’“ (p. 2) geistig durchgespielt wird.
[9] Hier liegt ein Mangel, der die Überwindung der älteren Vorstellung von Kulturaufgaben als in ‘anderen Räumen’ liegender Gestaltungen zwar schon bis zur empirischen Erreichbarkeit durch Invasion vorantreibt, doch verkennt, was mit dem oben erläuterten Gedanken der Wandlung räumlicher Expansionsvorstellungen in intellektuelle Transformation in dieser Welt schon berührt wurde. Für einen Moment ersteht hier die Vision eines Kolumbus der Alten Welt - doch ihr Inhalt gewinnt kein adäquate Form. Die vom Autor selbst schließlich noch innerhalb seines Lebens erreichte Gestalt der Theorie wird die Folgen dieser Verfehlung zeigen.
[10] Jack Williamson: Wing 4, Düsseldorf: Karl Rauch, 1952.
[11] ibid., p. 206.
[12] pp. 208, 205, 210.
[13] p. 208.
[14] So kann der Soziologe Wolfgang Engler in seinem großen Essay über Die Ostdeutschen etwa drei Biographien aus agrarischen Lebensräumen vorstellen, die bereits in der provinziellen DDR ein Maß an Brüchen aufwiesen, das, in einem Fall, zu dem prägnanten résumé führt: „So einer hat die Welt nie gesehen und dennoch nichts verpaßt.“ - Berlin: Aufbau, 3. A. 1999, pp. 261-265.
[15] Womit zugleich eingestanden ist, daß der Terminus Umwelt nicht einen kausalanalytisch rekonstruierbaren ‘Umraum’ zu bezeichnen hat, sondern einen Korrelationsbegriff aussagt: das, was schon für den biologischen Organismus die nach Maß seiner ‘Merkwelt’ konstituierte Umwelt ist. In diesem Sinne ist die moderne Evolutionsbiologie zu einem ökologischen Konzept gelangt, in dem die Beziehung von Organismus und Umwelt eine korrelative ist, was zu einer wesentlichen Korrektur älterer darwinistischer Annahmen über die Rolle und Funktion von Anpassung führte; cf. Ernst Mayr, Eine neue Philosophie der Biologie, München: Piper, 1991. - Die Pointierung des dem menschlichen Bewußtsein zuzuordnenden ‘Umraumes’ ist in Prägungen geleistet, die ausdrücken sollen, daß ‘jeder seine Welt’ habe. Daß diese wiederum aus vielen Wirklichkeiten bestehen kann, die in einer, heute nicht mehr selbstverständlich als logisch homogenisierbar unterstellten, Agglomeration vereint sind, ist eine der Facetten unseres Themas.
[16] Cf. Das Problem einer transklassischen Logik, in: id., Beiträge zur Grundlegung einer operationsfähigen Dialektik, 3 Bde., Hamburg: Meiner 1976, 1979, 1980; Bd. III, pp. 80-83.
[17] Cf. Metaphysik, Logik und Theorie der Reflexion, in: Beiträge I, l. c., bsd. pp. 49-63.
[18] l. sub [10] c., p. 210.
[19] Wenn nicht gefördert, so mindestens nicht behindert durch die Zugehörigkeit zur gleichen Wortfamilie, die das singulare tantum „the frontier“ im Sinne F. J. Turners und das plurale tantum „the frontiers“ als bildhafter Ausdruck für die ‘Ränder’ etablierten Wissens im amerikanischen Englisch aufweisen; cf. etwa Oxford Advanced Learners Dictionary, Oxford: University Press, 1989, Eintrag frontier.
[20] l. sub [10] c., p. 209.
[21] Daß es von einer allgemeinen Zeitstimmung zehrt, die ältere Orientierungen religiösen Typus in Orientierungen auf den empirischen Himmel und den erdnahen Kosmos transformierte und Hochhaus- oder Funkturmbauten genauso wie Raketenstarts oder Mondlandungen mit quasi-numinosem Schauder erfuhr, kann wohl mit Recht angenommen werden.
[22] Nach wenigen hundert Jahren der Entfaltung mathematischer Naturwissenschaften gehört deren Realitätsbegriff ebenfalls zum Alltagsbewußtsein, mindestens zu Sektoren von diesem: einmal in der erwartbaren Form popularisierten Bildungswissens, zum anderen aber in der Selbstverständlichkeit, mit der Naturwissenschaftler die Produkte ihrer symbolischen Praxis für ‘an sich’ existierende Sachen zu halten vermögen. Beispiel einer typischen Wendung ist etwa die des Physikers und Nobelpreisträgers Richard P. Feynman vom „Wunder einer Natur, die sich an ein solch elegantes und einfaches Gesetz wie das der Schwerkraft halten kann“. - id.: Vom Wesen physikalischer Gesetze, München: Piper, 3. A. 1997, p. 20.
[23] Cf. Gerd Irrlitz: Über die Struktur philosophischer Theorien, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Berlin: Akademie, H. 1, 1996 (44). - pp. 8-17.
[24] Es ordnet, dies nur nebenbei, die Bemühungen Günthers in die Traditionslinie ein, in der seit dem Geltungsverlust der repräsentativen Metaphysik an der ‘Rehabilitierung der Philosophie’ gearbeitet wird. - Cf. Herbert Schnädelbach: Philosophie in Deutschland 1831-1933, Frf./M.: Suhrkamp, 4. A. 1991; pp. 131-137.
[25] Hans Blumenberg: Arbeit am Mythos, Frf./M.: Suhrkamp, 1996 (5. A. 1990), p. 619.
[26] Eric Hobsbawm: Das Zeitalter der Extreme, l. sub [5] c., p. 365.
[27] cf.: Martin Heidegger und die Weltgeschichte des Nichts, in: Beiträge III, l. c., pp. 270-296.
[28] Zuerst in Grundzüge einer neuen Theorie des Denkens in Hegels Logik (Leipzig: Meiner, 1933; p. 72), zuletzt im Vorwort zu Beiträge II von 1978 (l. c., p. XVI); häufig verwendet im Aufsatz Metaphysik, Logik und die Theorie der Reflexion von 1957, in: Beiträge I, l. c., pp. 31-74; auch in Idee und Grundriß einer nicht-Aristotelischen Logik, Hamburg: Meiner, 1. A. 1959
[29] Grundzüge, l. c., und Vorwort, l. c., ausführlicher in Idee und Grundriß, l. c., p. 120.
[30] „Das ‘Noch’ will das Bewußtsein nicht aus seiner Vergangenheit entlassen. Alles Hängen am Sein .. ist von dem Blick auf die Vergangenheit fasziniert.“ - l. sub [27] c., p. 290.
[31] Beispielhaft etwa von Eric Hobsbawm formuliert: „Die Chaostheorie trug dazu bei, einer alten Kausalität eine neue Wendung zu geben. Sie zerstörte die alten Bindeglieder zwischen Kausalität und Vorhersehbarkeit, denn ihre Kernaussage heißt nicht, daß Geschehnisse zufällig seien, sondern vielmehr, daß die Auswirkungen von unterscheidbaren Ursachen nicht vorhersagbar sind. Außerdem trug sie zur Untermauerung einer anderen Theorie bei, die von Paläontologen entwickelt worden war und sich von großem Interesse für Historiker erwies. Sie besagt nämlich, daß die Ketten historischer und evolutionärer Entwicklungen nach einem Geschehen absolut kohärent und erklärbar seien, wohingegen keines all der möglichen Resultate bereits zu Beginn vorausgesagt werden könne.“ - Das Zeitalter der Extreme, l. c., p. 668.
[32] l. sub [27] c., pp. 274, 296.
[33] Der nach Vorstellung eines zahlfähigen Mengenumfangsmaßes gedacht ist. Die um den mathematischen Terminus „Mächtigkeit“ gebildeten Assoziationen, die noch zu diskutieren sind, und Neologismen wie „Mächtigkeitsgefälle“ transferieren immer wieder Metaphern in ihren Ursprung, hier anschauliche Größenvorstellungen, zurück.
[34] Idee und Grundriß, l. c., p.10.
[35] Sinnphilosophie, in: Hans Hartmann ed., Denkendes Europa, Berlin: Batschai, 1936, pp. 300ff.
[36] ibid., pp. 296f.
[37] Oder: meontische, nicht-Aristotelische, operational-dialektische etc.
[38] Herbert Schnädelbach: Philosophie in Deutschland 1831-1933, l. c., p. 87.
[39] Idee und Grundriß, l. c., p. 13.
[40] Hermann Schmitz: Rezension zu ‘Idee und Grundriß einer nicht-Aristotelischen Logik’, in: Phil. Rundschau, H. 4, 1962, pp. 283 ff.
[41] Idee und Grundriß, l. c., pp. 128f.
[42] In Das metaphysische Problem einer Formalisierung der transzendental-dialektischen Logik (Beiträge I, l. c., pp. 189-248) wird dann ausdrücklich auf Cantors Verwendung des Terminus rekurriert. - p. 191, Fn.
[43] ibid., p.129.
[44] ibid., p. 85.
[45] In Die aristotelische Logik des Seins und die nicht-Aristotelische Logik der Reflexion (Beiträge I, l. c., p. 142) schreibt Günther von der „Identitätsmetaphysik von Plato bis Schelling und Hegel“ und sagt voraus, daß „mit der Metaphysik des Stagiriten .. auch seine Logik metaphysischer Identität von Denken und Sein“ durch die Kritik fallen werde. - In Idee und Grundriß heißt es einmal: Dem „klassischen [Aristotelischen] Begriff des Formalismus“ liege das „dichotomische Schema“ von .. „Form und Inhalt der Erkenntnis“ zugrunde. Dieser salto, mortale für den mit ihm versuchten Gedanken, beruht auf der, als eine solche allerdings kaum zu begreifenden Unterstellung, daß die zitierte Dichotomie ebenso eine ist wie die wahr/falsch-Unterscheidung; l. c., p. 89.
[46] Man kann vermuten, daß die Überlegung hier einer Annäherung des Begriffs der Identität an den der Äquivalenz folgt. Allerdings ergibt dies für die Interpretation nichts Substantielles im Ganzen, wie sich zeigen wird.
[47] Verhandlungen des zweiten Hegelkongresses, Tübingen: Mohr/Haarlem: Willink u. Sohn, 1932. - pp. 104-120.
[48] p. 104.
[49] etwa in: Das Bewußtsein der Maschinen, Krefeld u. Baden-Baden: Agis, 1957, pp. 27-29, Die historische Kategorie des Neuen, in: Beiträge III, l. c., pp. 192f., Idee, Zeit, Materie, in: ibid., p. 238. - Daß die Identifikation der coincidentia oppositorum, der ‘Identität von Denken und Sein’ und des Isomorphismus nach Baer die Vermutung ermöglicht, die Metaphysik der ‘älteren Tradition’ behandle ‘Denken’ und ‘Sein’ als zwei Aussagebereiche, die durch logische Negation aufeinander abgebildet seien, bestimmt die Argumentation in Idee und Grundriß; cf. l. c. pp. 12, 14ff., 84f., 315ff et al.
[50] Ideen zu einer Metaphysik des Todes, in: Beiträge III, l. c., pp. 1-13. - cit. p. 4.
[51] So ist etwa zu lesen, daß Schelling, indem er etwas „nur im absoluten Bewußtsein oder in Gott„ begreife, „einfach Gott und Welt zweiwertig“ gegenüberstelle, oder daß man, wenn „die Welt drei metaphysische Wurzeln“ habe (Ich, Du, Es), zu einer „dreiwertigen formalen Logik“ käme. An anderer Stelle ist zu finden: „the tripartite division .. calls for a three-valued formal system“. Schließlich wird sogar behauptet, das animistische Bewußtsein sei in seiner Unfähigkeit, „Ich und Welt, also Seele und Ding, voneinander zu unterscheiden“, ein „einwertiges Bewußtsein“. Dazu wird nichts mehr zu sagen sein. - Das sich in der merkwürdige Rede von den drei „metaphysischen Wurzeln“ anzeigende echte Problem der Unterscheidung des Anderen sowohl von der Sache als auch vom Ich-Erlebnis wird weiter unten erörtert. - Cit. Idee und Grundriß, l. c., pp. 83, 91 und Beiträge II, l. c., pp. 119, 14f.
[52] Es „sind alle Dualismen Symptome von Symmetrie.“ - „Da .. Kant stillschweigend Zweiwertigkeit der Logik voraussetzt, existiert [für ihn] zwischen dem Urbild und seinem Abbild logische Symmetrie ..“; Kritische Bemerkungen zur gegenwärtigen Wissenschaftstheorie, in: Beiträge II, l. c., p. 159.
[53] Cf. das oben zur Baerschen Argumentation Gesagte.
[54] Charakteristisch dafür eine Erörterung, in der die Folgen des Umstandes behandelt werden, daß Hegel aus seinem Begriff von „Natur“ das echte novum ausgeschlossen und es ganz dem „Geist“ reserviert hatte. Hier ist formuliert, daß „die Hegelsche Kategorie des Neuen mit dem strukturellen Prinzip der Anisomorphie verbunden sein muß“, weil „Natur“ eine „Symmetrie von Seinssystemen„ bedeute, Geist als das Reich der echten Innovation aber „eine Manifestation eines asymmetrischen Verhältnisses“. „Geschichte“, schließt der Gedankengang, „ist nur ein umgangssprachlicher Ausdruck für strukturelle Asymmetrie der Wirklichkeit“ (Die historische Kategorie des Neuen, in: Beiträge III, l. c., pp. 191-194.). - Gemeint ist hier offenbar, daß „Geist“ oder Kultur von „Natur“ ‘nicht gedeckte’ Möglichkeiten besitzt - nur daß aus dem metaphorischen Rückgriff dieses Epithetons eine Rückbildung auf das ursprüngliche Bedeutungsfeld vollzogen und eine anschauliche Schematisierung abgeleitet wird, die den intendierten Gedanken undenkbar macht, da sie verlangte, eine geordnete Ansammlung abzählbarer ‘Möglichkeiten’ neben eine solche von ‘Wirklichkeiten’ zu stellen, um dann auf ‘Isomorphie’ oder ‘Symmetrie’ prüfen zu können.
[55] Besonders scharf hier K.-H. Ludwig, der Günther Unfähigkeit zur Beschränkung auf eine identifizierbare Problemstellung vorwirft: Gotthard Günthers Theorie einer nicht-Aristotelischen Logik, in: Phil. Jahrb., H. 85, 1978, pp.109-126. Selbst wenn man den Ton nicht billigen kann, mit dem hier an die Adresse eines jeden, also auch wissenschaftspolitischen Dominanzstrebens unverdächtigen Autors eine Kritik gerichtet wird, bleibt doch zu erkennen, daß Ludwig das problematische anschaulich-schematisierende Vorgehen Günthers zum Vorwurf hat; freilich ohne sich die Mühe zu machen, nach dessen Gründen zu fragen. Man sollte aber die in unserer Kultur etablierte systematische Rationalität auch deshalb nicht mehr für selbstverständlich halten, weil man sich so der Möglichkeit begäbe, ihre Besonderheiten zu identifizieren - und so erst in ihrem spezifischen Funktionssinn begreiflich und verteidigbar zu machen. - Auch H. Schmitz resümiert in seiner Rezension, daß die Resultate der Arbeit Günthers unbefriedigend seien, erkennt aber die Bedeutung der Frage an; cf. l. sub [40] c., p. 304 .
[56] Die vermeintlich explikativen oder begründenden Argumentationsgänge sind meist beschaffen wie dieser: „Wird .. eine .. Identität [gemeint ist wohl: Eigenschaft] durch ein logisch-positives Prädikat festgestellt, so kann die Negation dieses Prädikats nicht in den Bereich des Gegenstandes fallen. Sie muß dem Prozeß der Reflexion angehören [sic!] .. Die Prinzipien der Identität und des verbotenen Widerspruchs [sind] mehr oder weniger ‘interne’ Grundsätze des Denkens. Sie sagen nichts über seinen systematischen Geltungsbereich und dessen Grenzen aus. Gerade das aber tut der Satz vom ausgeschlossenen Dritten [sic!], wenn er feststellt, daß zwischen zwei kontradiktorischen Prädikaten [sic!], von denen eins den Gegenstand identifiziert und das andere als seine Negation die Reflexionssituation des logischen Subjekts vertritt [sic!], ein Drittes (Prädikat) systematisch und prinzipiell ausgeschlossen ist. Mit diesem Verbot ist der klassischen Reflexion eine Grenze gesetzt. Die Grenze wird etabliert durch das Prinzip der Zweiwertigkeit. Alle unmittelbare Reflexion beruht auf einem einfachen Symmetrieverhältnis zwischen Denken und Sein.“ (Idee und Grundriß, l. c., p. 127). - Die Differenz positiver und negativer Prädikationen wird hier der Unterscheidung von Gegenstand (der Bezugnahme) und ‘Reflexion’ (Bezugnahme) amalgamiert, dann gleichgesetzt mit der von wahren und falschen Aussagen, zuletzt noch mit der von ‘Denken und Sein’. Es wird kaum anderes übrig bleiben, als hier anschaulich schematisches Analogisieren zu sehen, mit dem sich zwanglos neben ‘Denken und Sein’ auch ‘Ich und Du’ oder beliebige „anthitetische Begriffe“ (l. c., p. 117) stellen lassen.
[57] l. sub [41] c., pp. 128f. - Günther zitiert Hermann Weyl, Philosophie der Mathematik und Naturwissenschaft, München: Leibniz, 1948, pp. 42f.
[58] ibid.
[59] Da zuzugestehen ist, daß der hier pointierte Aspekt nicht zwanglos sichtbar zu werden vermag, noch ein weiterer deskriptiver Versuch: Die ‘unabgeschlossene’ Folge ist, was sie ist, weil sie etwas wird, das sie nicht ist. Gesteht man zu, daß der prädikative ‘Punkt’, an dem sie als jenes ausgesagt wird, ehe ergänzt werden kann, daß sie als dieses zu präzisieren sei, ein infinitesimal kleiner ist, wird akzeptabel, den Begriff eines solchen Objekts als eine (intellektuelle) Bewegung, als den Fortgang entlang eines ideellen Verweisungsvektors zu konzipieren, wie Hegel es tat.
[60] Der Terminus ist durch Gadamer als topos hermeneutischer Verfahrensreflexion prominent geworden (cf. Wahrheit und Methode, Tübingen: Mohr, 4. A. 1975, pp. 278f. und p. 352). In seiner Präzisierung als eines ‘Vorgriffs auf Vollkommenheit’ wird er zwar für die Rekonstruktion der Hegelschen Intention, nicht aber prinzipiell zu belehnen sein, da die Konnotation des kriterienunbestimmten Wertprädikats problematisch ist. Die nähere Bestimmung als „Vollkommenheit einer Einheit von Sinn“ (p. 278) lenkt von der nüchternen und produktiveren Orientierung ab, die zu gewinnen wäre, nennte man sie nur eine ‘Vollständigkeit’ oder ‘Abgeschlossenheit’ einer Sinneinheit. Daß die Vollkommenheit zugleich auch als die der Adäquatheit des verstandenen Sinn-Objekts bezüglich der Frage, auf die es eine Antwort sei (p. 352), dazu als restlose Ausdrücklichkeit und, mehr noch, auch als vollendete Wahrheit (p. 279) verstanden werden soll, macht kenntlich, daß hier manche Bedeutungsmomente miteinander verwoben sind, die geschieden werden können und sollten. Über den letzteren ist Gadamer selbst in Zweifel, da er anderenorts zu akzentuieren vermag, daß die eigentliche Arbeit des Verstehens erst beginne, wenn der primäre Versuch, die Äußerung als reine und teilnahmefähige Wahrheit anzunehmen, gescheitert sei (Vom Zirkel des Verstehens, in: Kleine Schriften IV, Tübingen: Mohr, 1977, p. 59). Unserer Verwendung des Terminus liegt die zweite Bestimmung näher, die auch der ursprünglich Heideggerschen Anregung ähnlicher ist: der Vorgriff, um den es hier ging, war der einer Vorahnung, die man eine ‘Vorahmung’ zu nennen wagen könnte; die bestimmte Erwartung einer noch unbestimmten Antwort (Sein und Zeit, §2). Als verstanden in diesem Sinne gälte ein Objekt, dessen vollzogene Ausdeutung ‘Folge-Erwartungen’ induzierte, die im fortschreitenden Umgang mit ihm problemlos erfüllt würden, auf das man sich also gewissermaßen ‘richtig’ mit durch es beantwortbaren Fragen einstellen könnte. So hieße, einen Text zu verstehen, nicht, seinen Sinn endlich zu haben, sondern fähig zu sein, ihn mit den ‘richtigen Fragen’ immer wieder zu problemerschließenden Antworten ‘provozieren’ zu können. - Über die Differenz, einen Vorgriff als Element von Verstehensanstrengungen anzuerkennen oder ihn als Moment der teleologischen Struktur von Objektivierungsakten überhaupt einzuführen, wäre mehr zu sagen, als in dieser Arbeit geleistet werden kann. Immerhin wird mit dem hier gemachten Vorschlag eine nicht unwillkommene Nähe zum naturwissenschaftlichen Wissen sichtbar, da in der neuzeitlichen Naturwissenschaft als wahre Theorieaussage gilt, was durch technische Realisierung, mindestens im Experiment, eingelöst werden kann.
[61] Hans-Friedrich Fulda: Unzulängliche Bemerkungen zur Dialektik, in: Rolf-Peter Horstmann ed., Dialektik in der Philosophie Hegels, Frf./M.: Suhrkamp, 2. A. 1989, pp. 33-69. - cit. p. 64.
[62] Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, § 169.
[63] Es ist von eigentümlichem Reiz, daß Karl Kraus anläßlich einer Erläuterung des Titels von Schillers Jenenser Antrittsvorlesung zu bemerken wußte, man habe „in sprachdenklicherer Zeit“ in einem explizierenden Aussagesatz „einen ransitiven Gedanken, mit einer deutlichen Zielbestimmung von Subjekt zu Objekt“ erfaßt. Da zu vermuten ist, daß Kraus’ Behauptung nicht durch Hegel-Studien induziert ist, könnte sich, ließe sie sich an einigen Beispielen bekräftigen, eine des wohlfeilen Zirkelschlusses unverdächtige Interpretation im Lichte dieser Auffassung um eine fruchtbare Hegel-Deutung bemühen. Cf. Karl Kraus: Die Sprache, Frf./M.: Suhrkamp, 1987, p. 109. - H. Schmitz fand die plastische Formel, die Hegelsche Logik ergebe ein „vielfältig verschränktes System hinweisender Gebärden, die den Leser auffordern .., gewisse gedankliche Übergänge zu vollziehen“ (Rezension, l. sub [40] c., p. 298). Damit ist die Ubiquität des intellektuellen ‘Verweisungsvektors’, entlang dem die dialektischen Explikationen verlaufen, treffend benannt. ‘Gebärden’ kann allerdings nur als erläuternde Metapher angenommen werden, wie die in Kapitel 5 dieser Arbeit formulierte Kritik zeigen wird.
[64] Daß kein einzelnes Prädikat dies leistet, macht Hegel dann zum Vehikel des Fortgangs der bedeutungs-analytischen Explikation wie auch der Modellierung von Dynamik in den realistischen Anwendungen der Dialektik; cf. Enzyklopädie, §170: “ .. indem das Subjekt überhaupt und unmittelbar konkret ist, ist der bestimmte Inhalt des Prädikats nur eine der vielen Bestimmtheiten des Subjekts und dieses reicher und weiter als das Prädikat.“ Endlich erreichter Stillstand setzte voraus, daß alle Prädikationen aktual vollzogen würden. Der Nachweis, daß das Ende der Geschichte in der „Philosophie der Weltgeschichte“ nach diesem Muster theoretisch konstruiert wird, wäre ein Indiz für die Nützlichkeit des hier gemachten Vorschlags zur Identifikation des logischen Elementarkonstruktors bei Hegel. - Erkennbar ist aber schon, daß sich mit dieser Annahme der viel kritisierte normative Wahrheitsbegriff Hegels als konsequente Ableitung aus der antizipierenden Potenz des Ideellen erklären läßt.
[65] Kritik der reinen Vernunft, B 25.
[66] Bei Ernst Cassirer wird auch dieses Beispiel für das von ihm in gewissermaßen strukturalistischer Wendung verfochtene Primat des Funktionsbegriffs (der hier der Begriff einer erzeugenden Regel ist) vor dem Dingbegriff in Anspruch genommen. Daran wird für uns mit wünschenswerter Deutlichkeit kenntlich, daß die intuitiv als zulässig unterstellte freie Setzung eines bestimmten mathematischen Objekts es als ens a se erscheinen lassen muß, während doch zu fordern ist, daß seine differentielle Konstitution innerhalb der Ordnung, die es als Glied mit-konstituiert, eine Realisierung in explizit ausführbarer Konstruktion ermögliche. - Philosophie der symbolischen Formen, 3 Bde., Darmstadt: Wiss. Buchges., 1993; Bd. III, pp. 432-437; Cassirer stützt sich hier vor allem auf Hermann Weyl: Über die neue Grundlagenkrise der Mathematik, in: Mathemat. Zeitschrift, 10/1921, Berlin, Heidelberg: Springer, p. 53.
[67] Philip J. Davis/Reuben Hersh: Erfahrung Mathematik, Basel et al.: Birkhäuser, 1994, pp. 390-395. - Als Descartes seine revolutionäre Neuerung präsentierte, geometrische Probleme in algebraische ‘zu übersetzen’, gab es manchen Grund, über Verluste zu klagen: „Die Strenge der Begriffsbildung mußte durch den Ausschluß wichtiger und weitreichender Gebiete erkauft werden“, formuliert Ernst Cassirer das entstandene Problem. Es mußte sich erst erweisen, daß der Versuch nur zu eng angesetzt war und nicht eine überflüssige, sondern eine noch unvollendete Revolution vorging, die schließlich in der Verknüpfung der Geometrie mit der mathematischen Analysis die kritische Lücke schloß (woraus die Differentialgeometrie hervorging) und darin sofort die Überlegenheit des neuen systematischen Ansatzes erkennen ließ. Daß auch der intuitionistische Konstruktivismus solche Überraschungen bereiten könnte, ist nicht auszuschließen. - cf. Ernst Cassirer, Substanzbegriff und Funktionsbegriff, Darmstadt: Wiss. Buchges., 7. A. 1994, pp. 96-99; cit. p. 96.
[68] Idee und Grundriß, l. c., p. 129.
[69] Logik, Zeit, Emanation und Evolution, in: Beiträge III, l. c., p. 96.
[70] ibid., p. 97.
[71] Das zudem mit der Behauptung „Vergangenheit und Zukunft formen .. ihrerseits ein Tertium Non Datur, wobei die Messerschneide der Gegenwart die zweiwertige Umtauschrelation zwischen beiden repräsentiert“ (ibid) nicht wirklich gefördert wäre. Die großzügige Gleichsetzung der Zweiwertigkeit der Aussagenlogik, auf die Tertium non datur rekurriert, mit der Dichotomie anschaulich gedachter Zeitabschnitte führt auch hier nach nirgendwo. - Wie eng der gesuchte Konnex zwischen mehrwertiger Logik und nun auch Zeitlichkeit gedacht wird, zeigt zumal die Behauptung, ‘Dyadik’ (offenbar eine Algebra mit zwei Zahlwerten, etwa eine zweielementige Boolesche), kenne „nur den Unterschied von Sein und Nichts“ und arbeite „noch im Zeitlosen„ (vermutlich, weil sie die dritte Kategorie der Hegelschen Logik, Werden, nicht erfasse); Idee, Zeit und Materie, in: Beiträge III, l. c., p. 252.
[72] Der zweite Ausdruck bedeutet „Es gilt nicht: weder A noch nicht-A“, die möglichst treue Anlehnung an den Wortsinn von Tertium non datur. Mit dieser Betonung sollten alle übereilten Annahmen einer definitiven Entschiedenheit über genau A oder genau nicht-A behindert werden - hier soll nur gesagt werden: eine von beiden ist wahr, unausgemacht welche. Das Tertium non datur für den apagogischen Beweis anzuwenden setzt denn auch immer voraus, daß über mindestens eine Wahrheitswertbelegung entschieden ist.
[73] Kondakows Wörterbuch der Logik kann daher alle drei in einer Formulierung des ersten aussagen: „Nach dem Identitätssatz muß jeder in einem mittelbaren Schluß angeführte Gedanke bei seiner Wiederholung ein und denselben bestimmten stabilen Inhalt haben.“ - Leipzig: Bibl. Inst., 2. A. 1983, Eintrag Identitätssatz, p. 208. - Daß die Umformung mittels de-Morganscher Regeln die Geltung eben dieser Sätze voraussetzt, ist dabei kein Hindernis, wie sich versteht.
[74] Es ist eine präzise zu nennende Bestimmung Hans Blumenbergs, in seiner Unterstellung der Rhetorik als des Paradigmas aller, nach seiner Auffassung letzter Evidenzen unfähiger kultureller Setzungen demgegenüber, nur halb ironisch, ein principium rationis insufficientis zu formulieren. Auch, wenn eben dadurch erkennbar ist, daß ‘ratio sufficiens’ nicht der letzte aller jemals sondern nur der je möglichen Gründe zu sein hat, damit diesem Leibnizschen Prinzip produktiver Sinn zugemessen werden kann. Cf. Anthropologische Annäherung an die Aktualität der Rhetorik, in: Wirklichkeiten, in denen wir leben, Frf./M.: Suhrkamp, 1981, p. 124. - Zur Stellung des Prinzips bei seinem Urheber cf. die prägnante und erhellende Darstellung Ernst Cassirers in Das Erkenntnisproblem in Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit, 4 Bde., Darmstadt: Wiss. Buchges., 1994; Bd. II, Abschnitt Leibniz, bsd. pp. 132-141, 156-164.
[75] Jan Lukasiewicz, Philosophische Bemerkungen zu mehrwertigen Systemen des Aussagenkalküls, in: Comptes rendus de séances de la Sociétédes Sciences et de Lettres de Varsovie, Cl. III, XXIII, 1930, pp. 51-77. - Günther Patzig: Aristoteles, Lukasiewicz und die Ursprünge der mehrwertigen Logik, in: id., Gesammelte Schriften III, Göttingen: Wallstein, 1996, pp. 218-229. - Cf. Siegfried Gottwald: Mehrwertige Logik, Berlin: Akademie, 1989; pp. 5-9 et al.
[76]Er nennt ihn im Aufsatz On Determinism „indeterminate“, ohne zu berücksichtigen, daß dies gerade kein logisches Wertprädikat („third truth-value“) sondern das Prädikat in einer Aussage über die Nicht-Zuordnung eines Wertpädikats ist. Dabei ist ‘indeterminate’ hier neben ‘true’ und ‘false’ eingeordnet, denen die Zustände ‘possibility’, ‘being’ und ‘non-being’ „ontologically correspond“ - ein eleganter Vorschlag, alle unnötigen Komplikationen mit Wahrheitsmodalitäten, wenigstens hier, auszuschließen; cf. Selected Works (ed. Borkowski), Amsterdam, London: North-Holland Publ. Co., 1970; pp. 110-128. - cf. p. 126.
[77] Paul Lorenzen, Metamathematik, Mannheim: Bibl. Inst., 1962, pp. 11-22.
[78] Von eigentümlicher Unklarheit nicht nur in dieser Hinsicht ist aber Oskar Beckers Rezension von Lukasiewicz’ „Aristotle’s syllogistic from the standpoint of modern formal logic“, in: Gnomon, 1958 (30), pp. 261-264. - Der entscheidende Schritt läge darin, anzuerkennen, daß der Wahrheitswert keine ‘Eigenschaft’ des Satzes ist, sondern Resultat seiner Bewertung nach bestimmten Kriterien.
[79] Robert K. Merton, Die Eigendynamik gesellschaftlicher Voraussagen, in: E. Topitsch ed., Logik der Sozialwissenschaften, Köln, Berlin: Kiepenheuer u. Witsch, 1971, pp. 144-164.
[80] Philosophie der symbolischen Formen II, l. c., pp. 544-547.
[81] ibid., p. 547.
[82] Eine ausführliche und plastische Darstellung der den Satz vom Widerspruch verletzenden Diskurskonstellation, in der sowohl behauptet wurde, daß der ‘Äther’ ruhte, als auch, daß er bei Bewegung von Körpern mitgeführt wurde, und der Genese der Einsteinschen Lösung findet man etwa bei W. I. Rydnik, Vom Äther zum Feld, Moskau: MIR und Leipzig: Fachbuchverlag, 1979, pp. 110-123.
[83] Die Theorie der ‘mehrwertigen’ Logik, in: Beiträge II, l. c. - pp. 181-202; cf. p. 188.
[84] Werner Heisenberg: Prinzipielle Fragen der modernen Physik (Vortrag, Wien 1936), in: id., Wandlungen in den Grundlagen der Naturwissenschaften, Stuttgart: Hirzel, 11. A. 1980, pp. 62-76. - cit. p. 71.
[85] Logische Voraussetzungen und philosophische Sprache in den Sozialwissenschaften, in: Beiträge III, l. c., pp. 57-72; cit. p. 69. - Logistischer Grundriß und Intro-Semantik, in: Beiträge II, p. 89. - Das metaphysische Problem einer Formalisierung der transzendental-dialektischen Logik Hegels, l. c., p. 193.
[86] Idee und Grundriß, l. c., p. 103.
[87] Cf. Dieter Henrichs Urteil dazu als Voraussetzung seiner Diskussion der Hegelschen Begriffe Negation, Negatives etc. - Formen der Negation in Hegels Logik, in: R.-P. Horstmann ed., Dialektik in der Philosophie Hegels, l. c., pp. 213-229; bsd. pp. 213f.
[88] Cf. ibid. p. 216. - Auch Stekeler-Weithofer führt diese Deutung für seine Interpretation der Wissenschaft der Logik an, wenn er sie auch nicht konsequent nutzt; Hegels Analytische Philosophie, Paderborn et al.: Schöningh, 1992; cf. pp. 61, 99 und pp. 110f., 114-116.
[89] Nicolai Hartmann, Grundzüge einer Metaphysik der Erkenntnis, Berlin: de Gruyter, 2. A. 1925, pp. 287-290; Fumiyasu Ishikawa, Kants Denken von einem Dritten, Frf./M. et al.: Lang, 1990.
[90] Idee und Grundriß, l. c., p. 131.
[91] Phänomenologie des Geistes (Hoffmeister ed.), Berlin: Akademie, 1964, pp. 90-92: die Ding-Eigenschaften sind kumuliert: Salz ist weiß und auch scharf, doch schließen einander aus: weiß ist nicht scharf. - Voraussetzung dieser Argumentation ist die Deutung, daß scharf ein Bedeutungsteil von nicht-weiß sei.
[92] l. sub [90] c., p. 132.
[93] Cf. etwa Albert Menne: Das unendliche Urteil Kants, in: Philosophia Naturalis, XIX, 1982, pp. 151-162; id.: Einführung in die Logik, l. c., pp. 84f.
[94] Grundzüge einer Metaphysik der Erkenntnis, l. c., pp. 288f.
[95] In Kap. I der vorliegenden Arbeit erläutert.
[96] ibid., p. 133. - Hier ist deutlich erkennbar, wie der Anschluß an Hegels Argumentation aus der Phänomenologie des Geistes gesucht wird, indem aus der Prädikation ‘dornig’ abgeleitet wird, die Rose sei eben nicht nur ‘rot’, sondern auch ‘nicht rot’ - denn ‘dornig’ sei: nicht ‘rot’.
[97] p. 134.
[98] Das metaphysische Problem einer Formalisierung .., in: Beiträge I, l. c., pp. 229-231, 239, et al. - Cybernetic Ontology and Transjunctional Operators, ibid., pp. 249-328; bsd. pp. 278-297. - Da mit den Termini zwar eine erste Namensgebung geleistet, das Problem aber nur schematisch konstruierend wiederholt, keinesfalls jedoch bewältigt ist, wird in der vorliegenden Arbeit keine ausführliche Auseinandersetzung erfolgen. Im folgenden (fünften) Kapitel werden die so nur angedeuteten Unfertigkeiten an anderen Konstruktionselementen exemplarisch diskutiert.
[99] Der Terminus „Rejektion“ ist in der Formalen Logik wahrscheinlich bei Lukasiewicz zuerst verwendet worden, als Kontrastterminus zu „Assertion“; cf. id., Two-valued Logic, in: Selected Works ed. Borkowski, l. sub [76] c.; pp. 87f. - In der englischen Umgangssprache ist adverbiales „rejected“ Synonym für „weder-noch“, cf. Roget’s Thesaurus, London: Ramboro, 1988; Eintrag 610. - Ebenso will es Günther ausdrücklich verstanden wissen: Die Rejektion „negiert keine Werte mehr! Wohl aber negiert sie Fragestellungen ..“ - Die Metamorphose der Zahl, Anhang II zur 3. Aufl. von Idee und Grundriß, Hamburg: Meiner, 1991, p. 474.
[100] Identität, Gegenidentität und Negativsprache, in: Hegel-Jahrbuch 1979 Köln: Pahl-Rugenstein, 1980. - p. 27.
Bemerkung zum Begriff Kommunikation
Gerd K. Hartmann
Max-Planck-Institut für Aeronomie (MPAe)
Tel.: +49-5556-979-336, Fax: +49-5556-979-240; Email: ghartmann@linmpi.mpg.de
Juli 2001

Es sollte angemerkt werden, daß wir es heute mit einer seltsamen Unverbindlichkeit des Begriffes Information zu tun haben. Dieser Begriff weist auf die Zeit zurück, in der es weder die Informationstheorie Shannons gab noch deren Erweiterung, die Kommunkationstheorie, noch die recht junge Informatik, d.h. die Wissenschaft von Computern und den Grundlagen ihrer Anwendung. Von C. F. von Weizsäcker lernen wir, daß Computer nur die Information - ihre kleinstes Element hat er das Ur benannt - (unglaublich schnell) verarbeiten können, die aus entscheidbaren Alternativen zusammengesetzt werden kann. Wo das nicht gilt, ist kaum eine wesentliche Entscheidungs-Hilfe von der künstlichen Intelligenz (KI) der Computersysteme zu erwarten. Heute, wo man ohne großen Widerspruch herauszufordern sowohl sagen kann „alles ist Kommunikation“ als auch „Kommunikation ist alles“, ist es unklarer als früher, was wir meinen, wenn wir von Kommunikation sprechen. Das in den folgenden drei Bildern graphisch dargestellte Kommunikationsmodell kannen aber vielleicht zeigen wie Kommunikation entsteht. Es wurde in den 80ger Jahren von dem Autor zusammen mit seinem Freund Prof. Dr. K. C. Hsieh, Universität Tucson entwickelt.
Kommunikationsmodell Teil I
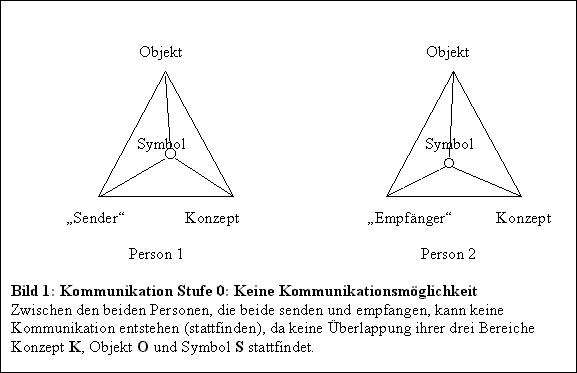
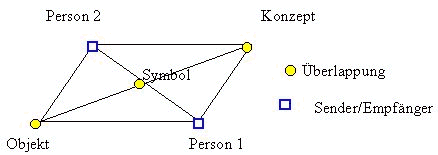
Bild 2: Kommunikation Stufe 3 : Die umfassendste Kommunikationsmöglichkeit
Die umfassendste Kommunkation kann zwischen zwei Personen entstehen - beide müssen sowohl „senden als auch empfangen“ - wenn sich alle drei Bereiche Objekt, Konzept und Symbol überlappen. Je größer der Überlappungsbereich, desto umfassender sind die Kommunikationsmöglichkeiten. Wegen des Komplementaritätsprinzips gibt es dabei aber auch unvermeidbare Unbestimmtheiten und Ungewißheiten, die um so größer sind, je kürzer der Zeitraum der Kommunikation ist. (Die Kommunikationsstufen 1 oder 2 bedeuten, daß sich jeweils nur ein Bereich oder zwei Bereiche überlappen).
Kommunikationsmodell Teil II
Bild 1: Kommunikation Stufe 0: Es entsteht keine Kommunikation zwischen den beiden Personen – den Sendern und Empfängern -, solange keine Überlappung der drei Bereiche Konzept K, Objekt O und Symbol S zwischen den beiden Personen stattfindet.
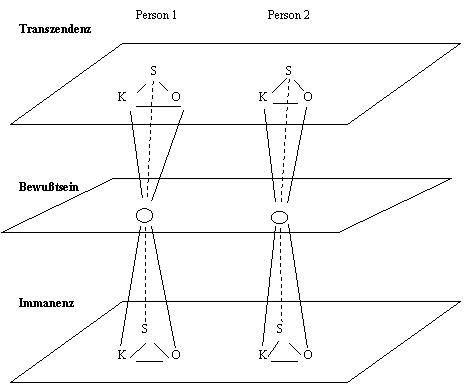
Bemerkung: Die transzendente Ebene und
die immanente Ebene sind mit einander verknüpft. Man kann sich das
vielleicht wie bei einer Klein’schen Flasche vorstellen – nicht Euklidsche
Topologie -, die eine Erweiterung des Möbius-Bandes in drei oder mehr
Dimensionen ist. (Das Möbius-Band hat nur eine Seite. Man erhält
es, wenn man einen Papierstreifen nimmt, an einem Ende um 180 Grad dreht
und zusammenklebt). Die Klein’sche Flasche hat nur eine Oberfläche.
Kybernetik
- Philosophie - Gesellschaft
Anmerkungen zu einer Tagung am 14. April 1961 bei der
Redaktion "Einheit"
Rainer Thiel; webmaster@thiel-dialektik.de
![]()
Zuvor gab es dort schon eine Initiativ-Tagung über
Psychologie in der DDR. Die Psychologie war nicht etwa unterdrückt, wurde
aber von Ideologen stiefmütterlich behandelt. Schlimmer war es mit der
Kybernetik. Beide Tagungen wurden gewiß nicht von der Redaktion initiiert,
sondern dank Einsatz von Aktivisten und per Wink von Walter Ulbricht. Drei Jahre
zuvor sollte in der Einheit eine Rezension von mir zu einem dinosaurischem Buch
über Relativitätstheorie aus der Feder des Chef-Philosophen der Parteihochschule
erscheinen. Inspiriert war der Dinosaurier nicht vom dialektischen, sondern
vom mechanistischen Materialismus, den schon Marx als Dialektiker verworfen
hatte. Aber so war das: Die Marx auf Pappschildern vorantrugen, waren zumeist
simple Mechanisten.
Doch statt meiner Rezension erschien erst mal der Chef-Philosoph bei mir im Institut - ich hatte gerade die Diplomarbeit fertig - und strich in meinem Manuskript herum. Zufällig kam Georg Klaus vorbei und sagte dem Chef-Philosophen: "Na Viktor, hat er dich gezaust?". Ja, so war es. Ich änderte ein wenig, aber die Redaktion war nicht zufrieden. Da sagte ich: "Mehr Kompromisse mache ich nicht."
Jetzt aber keimte Hoffnung. Zur Kybernetik sollte Klaus den Hauptvortrag halten. Klaus beauftragte mich, der Redaktion eine Teilnehmerliste vorzulegen. Da fragte mich der Redakteur: "Hast Du auch Parteilose dabei?" Ich sagte "nein, wir müssen uns erst mal als Genossen miteinander stoßen." Darauf der Redakteur: "Was wir uns als Genossen zu sagen haben, das können wir auch in Gegenwart von Parteilosen." So kam es auch, etwa jeder zweite Teilnehmer war parteilos, aber fast alle Teilnehmer waren für die Kybernetik, und so verlief die Tagung friedlich, mit vorsichtiger Kritik an den Ideologen. Ich gebe zu, die Teilnehmer so ausgewählt zu haben, daß Kompetenz überwog. Wir hatten ja auch nur einen Tag Zeit, um Signale zu setzen. Diese kleine Chance sollte nicht gefährdet werden.
Das Mildeste, was uns die Ideologen vorwarfen, war: "Ihr wollt die Philosophie ersetzen." Das war natürlich Unsinn. Zudem verfälschten Ideologen auch Hegel und Marx. (Das ist leicht nachzuweisen.) Ideologen waren nie wählerisch, wenn ihnen etwas zuwider war. Zumeist lasen sie die Bücher gar nicht, über die sie reden. Das ist bis heute so.
Der Bericht über die ungewöhnliche Kybernetik-Tagung bei der Zeitschrift als einem Organ des Zentralkomitees der SED, den ich verfassen durfte, erschien als Sonderbeilage zu Heft 7/1961. Trotz seines ungewöhnlichen Umfangs wurde der Bericht nicht in der ideologischen Literatur zitiert. Aber Klaus ging sofort weiter und initiierte in der Akademie der Wissenschaften eine Kybernetik-Kommission, die mehrere gründlichere und detaillierte Tagungen durchführte. Die Beiträge wurden gedruckt.
Verurteilung der Kybernetik wurde Ende der Sechziger nicht mehr offen ausgesprochen, weil Ulbricht 1967 - nunmehr unüberhörbar - für die Kybernetik votiert hatte. Stattdessen setzte unter den Ideologen Absonderung von Luftblasen ein, von Leuten, die nicht wussten und nicht wissen wollten, was Kybernetik ist. Das ist von outsidern als "Euphorie" bezeichnet worden, geht aber an der Sache vorbei. Es gab keine Kybernetik-Euphorie, sondern eine Inflation von Worthülsen. Das hatte mit Kybernetik nicht nur nichts zu tun, sondern verärgerte alle seriösen Leute und uns Promotoren, es brachte die Promotoren der Kybernetik in Misskredit und endete damit, daß Honecker bei seiner Machtübernahme alles in einen Topf warf. Man muß zugeben: halbwegs moderat. Doch schon am nächsten Tage riefen Philosophen und Parteifunktionäre: "Jetzt ist endgültig erwiesen, daß Psycho-Analyse und Kybernetik Pseudowissenschaften sind." Nur die Studentenzeitung "Forum" war für Vernunft offen. Man bat mich um eine vierteilige Folge "Mathematik-Sprache-Dialektik", daraus habe ich dann innerhalb von sechs Jahren in Feierabend-Arbeit das gleichnamige Buch gemacht.
Der ausführliche Bericht zur Tagung erschien als Beilage zu Heft 7, Juli 1961, der "Einheit", Zeitschrift für Theorie und Praxis des wissenschaftlichen Sozialismus.
Sie wollen mehr von Rainer Thiel lesen
? http://www.thiel-dialektik.de
Herausgeber,
Chefredaktion und verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes:
Siegfried Piotrowski,
Postfach 27 42, D - 58027 Hagen, Telefon/Telefax: + 49(0)2331/51559,
mailto:
siegfried@piotrowski.de, Internet: http://www.piotrowski.de,
Verlag:Piotrowski
& Piotrowski GbR, Schultenhardtstr. 27, D- 58093 Hagen,
Layout:
Daniel Piotrowski, Schultenhardtstr.
27, D - 58093 Hagen,
Copyright:
©2000 - 2001 All Rights
Reserved - Alle Rechte vorbehalten by/für Siegfried Piotrowski
im gleichen Verlag erscheint auch
europa dokumentaro
, http://www.europa-dokumentaro.de